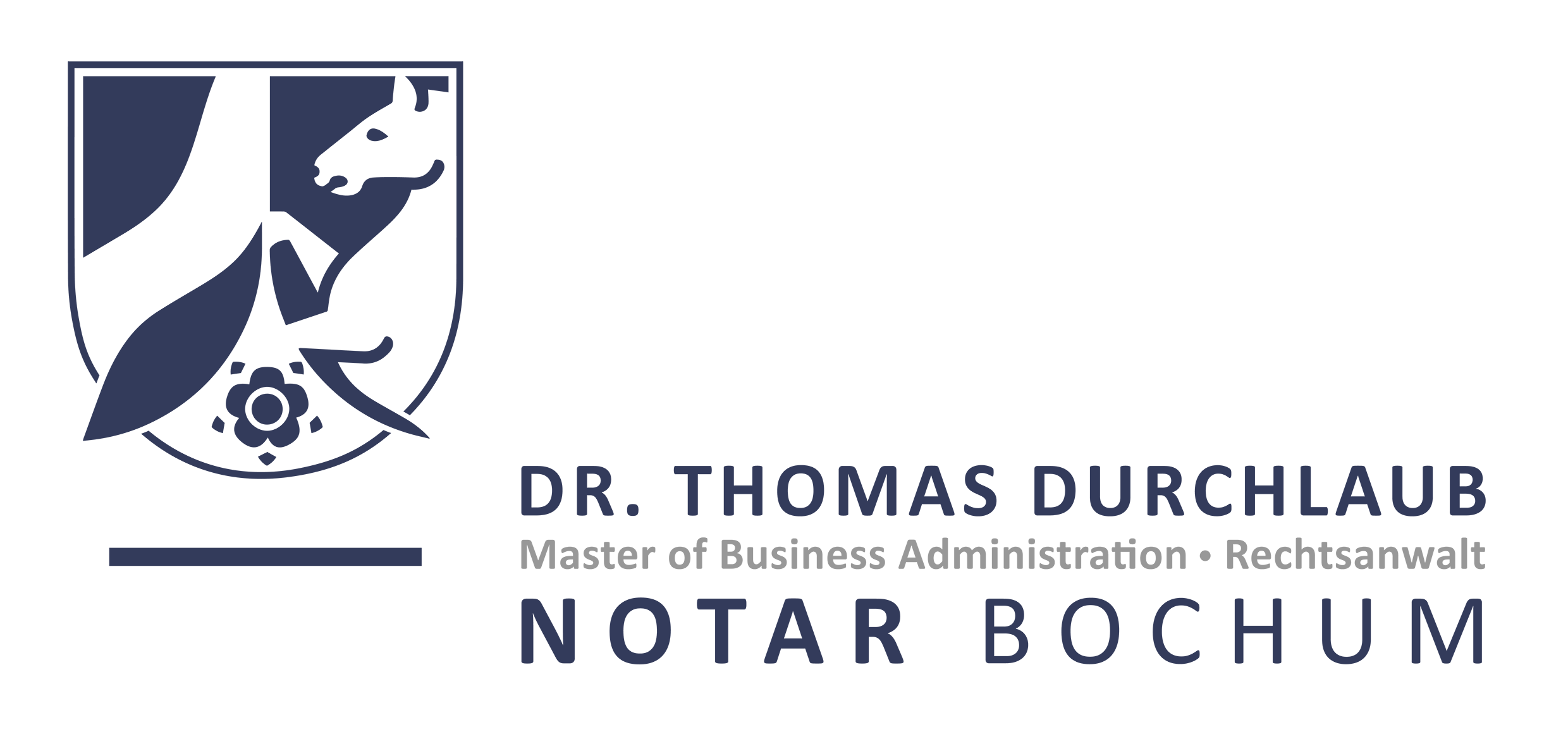Widerruf und Rücktritt von Testament, Ehegattentestament und
Erbvertrag im deutschen Erbrecht
Im deutschen Erbrecht gibt es klare Regelungen dafür, wie man ein Testament widerrufen oder unter bestimmten Voraussetzungen ein gemeinschaftliches Ehegattentestament aufheben beziehungsweise von einem Erbvertrag zurücktreten kann.
Diese Möglichkeiten sind wichtig, weil sich Lebensumstände ändern können: Eine neue Heirat oder Trennung, die Geburt weiterer Kinder, Zerwürfnisse in der Familie oder eine Veränderung der Vermögensverhältnisse können dazu führen, dass der letzte Wille angepasst werden muss. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die Themen Widerruf eines Testaments und den Widerruf und Rücktritt von Testament, Ehegattentestament und Erbvertrag und die Besonderheiten, die Sie dabei beachten müssen.Was ist der Unterschied zwischen Widerruf und Rücktritt?
Obwohl die Begriffe „Widerruf“ und „Rücktritt“ umgangssprachlich ähnlich klingen, gibt es im Erbrecht einen wichtigen Unterschied: Ein Testament kann man widerrufen, während man von einem Erbvertrag nur unter bestimmten Umständen zurücktreten kann.
Der Widerruf ist meist grundlos möglich, der Rücktritt erfordert einen gesetzlich anerkannten Grund oder eine vertragliche Vereinbarung. Im Ergebnis führen aber beide dazu, dass frühere Verfügungen unwirksam werden.
Widerruf bedeutet dabei die Aufhebung einer letztwilligen Verfügung, das heißt eines Testaments, durch den Erblasser selbst. Der Rücktritt bezeichnet demgegenüber den Rückzug aus einer bindenden Vereinbarung wie einem Erbvertrag oder in gewissem Sinne aus der Bindungswirkung eines gemeinschaftlichen Testaments, unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen.
Widerruf und Rücktritt ermöglichen es dem Erblasser, seine Nachlassplanung an veränderte Wünsche und Lebenslagen anzupassen. Während ein Testament grundsätzlich einseitig und frei geändert werden kann, schaffen Ehegattentestamente und Erbverträge Bindungen, die nicht ohne Weiteres auflösbar sind.
Was ist ein Widerruf?
Ein Widerruf bezieht sich auf ein Testament, das heißt eine letztwillige Verfügung. Da ein Testament eine einseitige, vom Erblasser allein getroffene Willenserklärung ist, kann der Erblasser sie grundsätzlich jederzeit und ohne Angabe von Gründen aufheben oder abändern (§ 2253 BGB).
Der Widerruf eines Testaments erfolgt durch Vornahme einer neuen letztwilligen Verfügung oder durch bewusste Vernichtung der Testamentsurkunde, wie weiter unten beschrieben. Ein Widerruf ist also kein Vertrag, sondern eine einseitige Änderung des letzten Willens.
Was ist ein Rücktritt?
Ein Rücktritt ist in rechtlicher Hinsicht der Austritt aus einem Vertrag. Im Erbrecht spricht man vor allem beim Erbvertrag von Rücktritt, weil ein Erbvertrag zwischen Erblasser und Vertragspartner geschlossen wird und beide sich daran binden. Einseitig davon loszukommen, erfordert besondere Voraussetzungen, wie zum Beispiel einen im Vertrag vorbehaltenen Rücktritt oder einen vom Gesetz anerkannten Grund.
Ohne solche Gründe ist ein Erbvertrag, anders als ein Testament, nicht frei widerruflich. Auch beim gemeinschaftlichen Ehegattentestament wird gelegentlich von „Rücktritt“ gesprochen, wenn ein Ehepartner die bindende Wirkung lösen möchte – rechtlich handelt es sich jedoch auch hier um einen Widerruf wechselbezüglicher Verfügungen nach § 2271 BGB.
Gesetzliche Grundlagen (BGB) zu Widerruf und Rücktritt im Überblick
Die wichtigsten Vorschriften zum Widerruf und Rücktritt finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Zentrales Prinzip ist in § 2253 BGB festgehalten: „Der Erblasser kann ein Testament […] jederzeit widerrufen.“. Das bedeutet, ein Einzeltestament kann vom Testator grundsätzlich immer aufgehoben oder geändert werden.
Die §§ 2254 bis 2258 BGB regeln verschiedene Widerrufsmethoden im Detail – etwa das Widerrufstestament, die Vernichtung der Urkunde oder die Errichtung eines späteren, widersprechenden Testaments. Ebenfalls relevant ist § 2256 BGB, der den Widerruf durch Rücknahme eines notariellen Testaments aus amtlicher Verwahrung ermöglicht.
Für gemeinschaftliche Testamente von Eheleuten enthält § 2271 BGB Sonderregeln, insbesondere zur Bindungswirkung wechselbezüglicher Verfügungen und deren Widerruf. Die §§ 2290–2292 BGB betreffen die Aufhebung von Erbverträgen, wie etwa durch gegenseitigen Vertrag oder ein gemeinsames Ehegattentestament, während die §§ 2293–2295 BGB die Rücktrittsrechte von Erbvertragsparteien aufzählen.
Zudem schreibt § 2296 BGB die Form für Rücktrittserklärungen vor, und § 2297 BGB erlaubt unter bestimmten Umständen eine Aufhebung der vertragsmäßigen Verfügungen durch Testament nach dem Tod des Vertragspartners.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Testamente bieten Flexibilität, da sie grundsätzlich frei widerruflich sind. Erbverträge hingegen haben eine starke Bindungswirkung, sodass Änderungen nur eingeschränkt möglich sind. Im Folgenden beleuchten wir die Unterschiede zwischen Widerruf und Rücktritt und die konkreten Vorgehensweisen bei Testament, Ehegattentestament und Erbvertrag.
Wie kann ich ein notarielles Testament widerrufen?
Ein Testament widerrufen kann man auf verschiedene Arten. Welche Widerrufsmöglichkeiten konkret bestehen, hängt davon ab, ob es sich um ein Einzeltestament oder ein gemeinschaftliches Ehegattentestament handelt. Nachfolgend werden die verschiedenen Wege in diesem Artikel verständlich erläutert.
Einzeltestament: Kann ein notarielles Testament widerrufen werden?
Ein Einzeltestament, also ein vom Erblasser allein erstelltes Testament, kann jederzeit widerrufen werden. Der Erblasser kann auch jede im Testament enthaltene Verfügung jederzeit widerrufen. Dafür muss kein besonderer Grund angegeben werden. Der Erblasser hat hierbei mehrere Möglichkeiten:
Widerruf: Testament neu erstellen (§ 2254 BGB)
Der Erblasser kann ein Widerrufstestament (§ 2254 BGB) errichten, in dem er ausdrücklich erklärt, dass ein früheres Testament oder bestimmte Verfügungen aus diesem Testament widerrufen werden. Zum Beispiel kann er schreiben: „Hiermit widerrufe ich mein Testament vom 01.01.2020.“ Ein solches neues Testament muss denselben Formvorschriften genügen wie jedes Testament – also handschriftlich geschrieben und unterschrieben sein oder notariell beurkundet werden.
Wichtig ist, dass der Widerruf eindeutig formuliert ist; ein pauschaler Vermerk wie „ungültig“ auf dem alten Testament kann problematisch sein. Auch wenn Gerichte ein einzelnes Wort unter Umständen genügen lassen, sollte man auf Nummer sicher gehen und den Widerruf klar und formgerecht erklären.
Alternativ muss ein neues Testament nicht ausdrücklich den Widerruf erwähnen, es genügt auch eine widersprechende letztwillige Verfügung: Verfasst der Erblasser ein späteres Testament mit anderem Inhalt, hebt dieses das frühere insoweit automatisch auf (§ 2258 BGB). Daher bewirkt ein neuer letzter Wille regelmäßig den Widerruf eines älteren Testaments, zumindest soweit beide nicht nebeneinander bestehen können.
Widerruf durch Vernichtung der Urkunde (§ 2255 BGB)
Eine einfache und häufig genutzte Methode um das Testament zu widerrufen ist, ein handschriftliches Testament zu zerstören, zum Beispiel durch Zerreißen oder Verbrennen. Entscheidend ist die Absicht des Erblassers, damit das Testament außer Kraft zu setzen. Wird das Original-Testament absichtlich vernichtet, gilt es rechtlich als widerrufen (§ 2255 BGB).
Achtung: Der Erblasser muss dazu natürlich Zugriff auf die Urkunde haben – hat er Kopien verteilt, sollten auch diese zurückgeholt werden. Bei einem notariellen Testament, das sich in amtlicher Verwahrung befindet, kann man es nicht selbst vernichten; hier greift die nächste Möglichkeit.
Widerruf durch Rücknahme aus amtlicher Verwahrung (§ 2256 BGB)
Wurde das Testament notariell beurkundet und beim Amtsgericht hinterlegt, kann der Erblasser es aus der amtlichen Verwahrung zurücknehmen. Die Rücknahme aus der besonderen amtlichen Verwahrung gilt nach dem Gesetz als Widerruf (§ 2256 BGB).
Praktisch bedeutet dies: Der Erblasser stellt beim Nachlassgericht einen Antrag, sein verwahrtes Testament herauszugeben. Die Rückgabe wird dokumentiert. Ab diesem Zeitpunkt ist das notarielle Testament widerrufen. Würde der Erblasser es danach wieder neu hinterlegen wollen, müsste es erneut förmlich errichtet werden.
Testierfähigkeit ist Voraussetzung für den Widerruf eines Testaments – der Erblasser muss im Moment des Widerrufs geschäftsfähig bzw. testierfähig sein. Ist er es nicht, wie zum Beispiel wegen fortgeschrittener Demenz, kann er keinen wirksamen Widerruf vornehmen. Ein von einem Testierunfähigen zerrissenes Testament bleibt gültig, falls die Testierunfähigkeit nicht schon bei der Errichtung bestand.
Wie widerrufe ich ein gemeinschaftliches Testament?
Ein Ehegattentestament, das heißt ein gemeinschaftliches Testament von Ehegatten, wie zum Beispiel das bekannte Berliner Testament, unterliegt besonderen Regeln. Grundsätzlich können die Ehegatten ein solches gemeinsames Testament gemeinsam jederzeit widerrufen, solange beide noch leben und die Ehe besteht. Der gemeinsame Widerruf kann ähnlich erfolgen wie beim Einzeltestament.
Gemeinsames Widerrufstestament oder neues gemeinsames Testament
Die Eheleute können zusammen ein neues Testament aufsetzen, in dem sie erklären, dass sie das frühere gemeinschaftliche Testament vollständig oder teilweise aufheben. Dieses neue gemeinschaftliche Testament muss wieder von beiden Ehepartnern handschriftlich verfasst und unterschrieben sein oder notariell beurkundet werden.
Alternativ können sie ein gemeinsames Testament mit abweichenden Verfügungen erstellen – steht dieses inhaltlich im Widerspruch dem früheren Testament, hebt es das ältere insoweit auf, sofern beide Partner es gemeinsam errichtet haben.
Vernichtung der Testamentsurkunde
Handelt es sich um ein eigenhändiges (privatschriftliches) Ehegattentestament, können beide Eheleute einvernehmlich die Urkunde vernichten oder durchstreichen, um das Testament aufzuheben. Wichtig ist, dass beide einverstanden sind – ein einseitiges Zerreißen durch einen Ehepartner ohne Wissen des anderen wäre problematisch, da hier die gemeinsame Willensbildung fehlt.
Rücknahme aus amtlicher Verwahrung
Haben die Ehegatten ein notarielles gemeinschaftliches Testament in amtliche Verwahrung gegeben, können sie nur gemeinsam die Rücknahme beantragen. Die gemeinsame Rücknahme des notariellen Testaments beim Amtsgericht wirkt als gemeinsamer Widerruf.
Kann ich ein gemeinschaftliches Testament ändern?
Solange beide Ehepartner leben und die Ehe intakt ist, ist jedoch ein einseitiger Widerruf der wechselseitigen Verfügungen nicht ohne Weiteres möglich. § 2271 Abs.1 Satz 2 BGB schreibt vor, dass ein gemeinschaftliches Testament während der Ehe nur von beiden Ehegatten zusammen widerrufen werden kann.
Das heißt, ein Ehegatte alleine kann nicht einfach durch ein neues Einzeltestament die gemeinsamen Verfügungen aushebeln – dieses würde ins Leere gehen. Viele Menschen denken irrtümlich, ein späteres Einzeltestament eines Ehegatten beseitige das frühere gemeinschaftliche Testament automatisch, in der Praxis ist das jedoch ein Irrtum.
Was passiert mit einem Testament bei Scheidung?
Eine wichtige Ausnahme ergibt sich bei Scheidung. Lassen sich die Ehegatten später scheiden oder ist die Scheidung zum Todeszeitpunkt bereits anhängig, wird ein zuvor errichtetes Ehegattentestament in der Regel unwirksam (§§ 2268, 2077 BGB), sofern im Testament nicht ausdrücklich etwas anderes für diesen Fall bestimmt wurde.
Das bedeutet, nach rechtskräftiger Scheidung gelten die gegenseitigen Verfügungen meist als aufgehoben. Aber Vorsicht: In der Trennungsphase vor der Scheidung bleibt das Testament zunächst gültig, denn die Ehe besteht rechtlich noch. Wer in Trennung lebt und vermeiden will, dass der (Noch-)Ehepartner im Todesfall erbt, muss aktiv werden.
Rücktritt vom Ehegattentestament: einseitiger Widerruf durch einen Ehegatten
Was passiert, wenn nur ein Ehegatte das gemeinschaftliche Testament aufheben will, der andere aber (noch) nicht? Dies kann z.B. bei langer Trennung oder zerrütteter Ehe der Fall sein, bevor eine Scheidung vollzogen ist. Hier spricht man vereinfacht vom „Rücktritt vom Ehegattentestament“, rechtlich ist es ein einseitiger Widerruf wechselbezüglicher Verfügungen gemäß § 2271 BGB.
Kann ein gemeinsames Testament einseitig widerrufen werden?
Ein einseitiger Widerruf ist möglich, solange beide Ehegatten noch leben. Allerdings sind strenge formale Anforderungen zu beachten: Der Widerruf muss notariell beurkundet und dem anderen Ehegatten offiziell zugestellt werden.
Konkret heißt das: Der widerrufswillige Ehepartner erklärt vor einem Notar seinen Widerruf des gemeinschaftlichen Testaments. Diese Erklärung wird vom Notar beurkundet (§ 2271 Abs.2 BGB in Verbindung mit § 2296 Abs.2 BGB). Anschließend muss die notarielle Widerrufserklärung dem anderen Ehepartner zugehen (in der Praxis oft durch Zustellung des Notars oder Gerichtsvollziehers).
Erst mit Zugang beim anderen wird der Widerruf wirksam. Wichtig: Der andere Ehegatte muss nicht zustimmen – er muss nur die Erklärung erhalten. Selbst wenn er damit nicht einverstanden ist und Widerspruch einlegen möchte, gilt das gemeinschaftliche Testament damit als von dem einen Partner aufgekündigt.
Wann ist das Berliner Testament ungültig?
Die Folge eines solchen einseitigen Widerrufs ist, dass die bindenden Verfügungen des Ehegattentestaments, soweit sie wechselbezüglich waren, also in gegenseitiger Abhängigkeit standen, nicht mehr gelten. Beide Ehepartner können dann wieder frei testieren, als hätte es das gemeinsame Testament nicht gegeben.
In der Praxis wird der widerrufende Ehegatte nach erfolgtem Widerruf typischerweise ein neues Einzeltestament errichten, um seine Wünsche festzulegen – andernfalls würde im Todesfall die gesetzliche Erbfolge greifen oder ein noch älteres Testament aufleben.
Kann ein Berliner Testament vom überlebenden Ehepartner geändert werden?
Was ist, wenn einer der Ehegatten bereits verstorben ist? In diesem Fall erlischt das Recht zum Widerruf mit dem Tod des anderen (§ 2271 Abs.2 Satz 1 BGB). Das bedeutet: Der überlebende Ehepartner ist an die wechselbezüglichen Verfügungen nun grundsätzlich gebunden.
Ein Widerruf des gemeinschaftlichen Testaments ist nach dem Tod des Partners nicht mehr möglich. Der überlebende Ehegatte kann also zum Beispiel die Schlusserbeneinsetzung (meist der Kinder) nicht mehr einseitig abändern – das ist ja gerade der Sinn der Bindungswirkung eines Berliner Testaments.
Wann erben die Kinder bei einem Berliner Testament?
Es gibt jedoch einen letzten Ausweg, der in § 2271 Abs.2 Satz 2 BGB vorgesehen ist: Der Überlebende kann seine eigene letztwillige Verfügung aufheben, wenn er die ihm vom verstorbenen Ehegatten Zugewendete (Erbschaft) ausschlägt. Das heißt, der überlebende Ehepartner kann innerhalb der gesetzlichen Ausschlagungsfrist das Erbe des Erstverstorbenen ablehnen; dadurch verliert er zwar seinen Erbanspruch, ist aber im Gegenzug nicht mehr an das gemeinschaftliche Testament gebunden.
Er kann dann über sein eigenes Vermögen wieder frei verfügen. Dieser Schritt will gut überlegt sein – die Ausschlagung muss innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnis vom Anfall der Erbschaft erfolgen und bewirkt, dass eventuell andere, wie die Kinder, sofort Erben des Erstverstorbenen werden. Die Ausschlagung ist praktisch der „Rücktritt“ des Überlebenden nach dem Tod des Partners, allerdings um den Preis des Verlusts des eigenen Erbteils.
Was passiert mit dem Testament bei einer Trennung?
Ehegatten, die sich in Scheidung befinden oder dauerhaft getrennt leben, sollten nicht darauf vertrauen, dass das gemeinschaftliche Testament automatisch unwirksam wird. Solange die Scheidung nicht rechtskräftig ist, bleibt die Bindungswirkung bestehen.
Möchte man verhindern, dass der andere im Todesfall noch erbt, sollte man aktiv den notariellen Widerruf erklären. Ein neues Testament oder ein Brief an den Partner genügt hier nicht – es muss der formale Weg eingehalten werden.
Kann ich einen Erbvertrag rückgängig machen?
Ein Erbvertrag ist ein Vertrag, in dem der Erblasser sich bereits zu Lebzeiten vertraglich bindet, bestimmte Verfügungen von Todes wegen zu treffen, also typischerweise jemanden als Erben einzusetzen.
Häufig geschieht dies gegen eine Gegenleistung oder im familiären Kontext, wie zum Beispiel ein Unternehmen, das nur an ein Kind übertragen wird, wenn es per Erbvertrag als Alleinerbe eingesetzt wird.
Wie löst man einen Erbvertrag auf?
Anders als ein Testament kann ein Erbvertrag nicht einseitig frei widerrufen werden – beide Parteien sollen sich ja auf die Vereinbarung verlassen können. Dennoch gibt es Möglichkeiten, einen Erbvertrag aufzuheben oder aus ihm auszusteigen:
Aufhebung im Einvernehmen (§ 2290 BGB)
Am einfachsten ist es, wenn alle Vertragspartner einverstanden sind, den Erbvertrag aufzuheben. Gemäß § 2290 Abs.1 BGB kann ein Erbvertrag durch Vertrag zwischen den ursprünglichen Parteien aufgehoben werden.
Das heißt, Erblasser und der/die Vertragspartner schließen gemeinsam einen Aufhebungsvertrag (schriftlich beim Notar), der den Erbvertrag beendet. Diese einvernehmliche Aufhebung erfordert natürlich die Zustimmung aller Beteiligten, ist aber jederzeit möglich und wirksam, sofern notarielle Form gewahrt ist.
Aufhebung durch neues gemeinschaftliches Testament (§ 2292 BGB)
Wenn die Vertragsparteien Eheleute oder eingetragene Lebenspartner sind, können sie einen Erbvertrag auch durch ein gemeinschaftliches Testament aufheben. Beispielsweise können Eheleute, die einen Erbvertrag geschlossen hatten, später ein neues Berliner Testament errichten, das den früheren Erbvertrag ersetzt – auch das sieht das Gesetz vor. Voraussetzung ist wiederum, dass beide mit dieser Änderung einverstanden sind und entsprechend gemeinsam testieren.
Einseitiger Rücktritt vom Erbvertrag
Will der Erblasser allein sich vom Erbvertrag lösen und liegt keine einvernehmliche Aufhebung vor, bleibt nur der Rücktritt nach den engen gesetzlichen Vorgaben. Das Gesetz nennt in §§ 2293–2295 BGB drei Fälle, in denen der vertragsgebundene Erblasser zurücktreten kann:
Rücktrittsvorbehalt (§ 2293 BGB)
Im Erbvertrag kann von vornherein ein Rücktrittsrecht vereinbart werden. Der Erblasser behält sich dadurch ausdrücklich das Recht vor, unter bestimmten Bedingungen – oder sogar ohne Angabe von Gründen – vom Erbvertrag zurückzutreten.
Oft wird vereinbart, dass der Erblasser zurücktreten darf, wenn der Vertragspartner eine bestimmte Verpflichtung nicht erfüllt. Ist das Rücktrittsrecht an eine Pflichtverletzung geknüpft, muss der Erblasser den anderen vor dem Rücktritt normalerweise abmahnen und Gelegenheit zur Erfüllung geben. Wird ein solcher vertragliche Vorbehalt gezogen, gilt der Erbvertrag als aufgehoben, sobald der Rücktritt erklärt und formgerecht übermittelt wurde.
Rücktritt wegen Verfehlung des Bedachten (§ 2294 BGB)
Hat der im Erbvertrag Bedachte, wie der versprochene Erbe, sich gegenüber dem Erblasser schwer vergeht, kann der Erblasser zurücktreten. Die Messlatte liegt hier hoch: Es muss eine Verfehlung vorliegen, die so gravierend ist, dass sie den Erblasser zur Entziehung des Pflichtteils berechtigen würde.
Beispiele: Der Bedachte bedroht oder misshandelt den Erblasser, versucht ihn zu töten oder begeht andere schwere Straftaten gegen ihn (§ 2333 BGB listet solche Gründe).
Nur solche nach Vertragsschluss begangenen Verfehlungen berechtigen zum Rücktritt. Dieser gesetzliche Rücktrittsgrund schützt den Erblasser davor, an einen untreuen oder gewalttätigen Vertragspartner gebunden zu bleiben.
Wichtig: Betrifft die Verfehlung einen Dritten, zum Beispiel beleidigt der Vertragspartner jemand anderen oder liegt nur eine Entfremdung vor, reicht das nicht – es muss eine qualifizierte Verfehlung gegenüber dem Erblasser selbst sein.
Rücktritt bei Wegfall der Gegenleistung (§ 2295 BGB)
Häufig wird ein Erbvertrag im Zusammenhang mit einer Gegenleistung des Bedachten geschlossen, z.B. verpflichtet sich dieser, den Erblasser zu pflegen oder ihm Unterhalt zu gewähren. Wenn eine solche vertragliche Gegenverpflichtung aufgehoben wird, darf der Erblasser vom Erbvertrag zurücktreten.
Praktisches Beispiel: Ein Mann setzt per Erbvertrag seine Pflegerin als Alleinerbin ein, und die Pflegerin verpflichtet sich, ihn bis zum Lebensende zu betreuen. Wenn der Pflegevertrag später aufgehoben oder gekündigt wird, sei es, weil die Pflegeperson ausfällt oder andere Umstände eintreten, kann der Erblasser gem. § 2295 BGB den Erbvertrag widerrufen, da die Grundlage – die Gegenleistung – entfallen ist.
Allerdings genügt schlechte Erfüllung der Pflicht nicht automatisch; der völlige Wegfall oder die Aufhebung der Verpflichtung ist erforderlich, der Gesetzgeber wollte hier kein allgemeines Leistungsverweigerungsrecht schaffen, deshalb sind z.B. Zahlungsverzug allein kein Rücktrittsgrun)
Kann ein Erbvertrag widerrufen werden?
Um von einem Erbvertrag wirksam zurückzutreten, muss der Erblasser eine Rücktrittserklärung notariell beurkunden lassen und dem Vertragspartner zustellen (§ 2296 Abs.2 BGB). Diese Formalie ähnelt also dem einseitigen Widerruf beim Ehegattentestament.
Die Erklärung ist höchstpersönlich vom Erblasser abzugeben – ein Stellvertreter kann ihn dabei nicht ersetzen. Nach Zugang der Rücktrittserklärung beim anderen gilt der Erbvertrag als aufgehoben. Hat der Vertragspartner den Erblasser seinerseits durch den Vertrag bedacht (z.B. gegenseitiger Erbvertrag), kann er natürlich ebenfalls nur unter diesen strengen Bedingungen zurücktreten.
Kann ein Erbvertrag nach dem Tod geändert werden?
Ist der andere Vertragspartner bereits verstorben, kann der Erblasser unter Umständen noch durch Testament von den vertragsmäßigen Verfügungen abrücken (§ 2297 BGB). Diese Regel greift z.B., wenn zwei Personen einen Erbvertrag geschlossen haben und der Vertragspartner stirbt – der verbleibende Erblasser könnte dann in einem neuen Testament die früher vertraglich getroffenen Verfügungen aufheben.
Voraussetzung ist aber, dass er sonst an den Vertrag gebunden bliebe; oft endet ein Erbvertrag mit dem Tod des Vertragspartners ohnehin, außer der Vertrag begünstigt dessen Erben. Im Zweifel sollte auch hier rechtlicher Rat eingeholt werden.
Wann verliert ein Erbvertrag seine Gültigkeit?
Ein Erbvertrag schränkt die Testierfreiheit erheblich ein. Ohne wirksame Aufhebung oder Rücktritt bleibt ein Erbvertrag bindend. Würde der Erblasser entgegen der Bindung ein neues Testament verfassen, das dem Erbvertrag widerspricht, so wäre dieses neue Testament in den vertragswidrigen Verfügungen unwirksam.
Der vertraglich Bedachte könnte dann nach dem Tod des Erblassers seinen Erbanspruch durchsetzen, ungeachtet des späteren Testaments. Daher ist es essenziell, bei Änderungswünschen formal korrekt vorzugehen, sei es durch notariellen Rücktritt oder einen Aufhebungsvertrag.
Formale Voraussetzungen für einen wirksamen Widerruf oder Rücktritt
Sowohl beim Widerruf eines Testaments als auch beim Rücktritt von einem Erbvertrag spielt die Form eine große Rolle. Fehler in der Form können dazu führen, dass der Widerruf unwirksam ist – mit der Folge, dass das alte Testament oder der alte Vertrag doch noch gilt. Auf was muss man also achten?
Für normale Testamentswiderrufe, durch neues Testament oder Vernichtung, genügt die Einhaltung der Testamentsform bzw. eine klare Vernichtungshandlung. Für kompliziertere Fälle – einseitige Schritte bei gemeinschaftlichen Testamenten oder Erbverträgen – ist die notarielle Beurkundung Pflicht. Hält man die Form nicht ein, bleibt der alte letzte Wille bestehen.
Kann man ein Testament widerrufen?
Ein neues Widerrufstestament muss die gleichen Formvorschriften erfüllen wie ein normales Testament. Das heißt, es muss entweder eigenhändig handschriftlich verfasst und vom Erblasser voll unterschrieben sein oder als notarielles Testament beurkundet werden.
Ein am Computer getipptes und nur unterschriebenes Dokument wäre ungültig. Ebenso sollte ein Widerrufstestament mit Datum und Ort versehen werden, um Klarheit zu schaffen. Das Datum hilft zu erkennen, dass es neuer ist als vorherige Verfügungen. Eine mündliche Widerrufserklärung reicht niemals – Testamente und damit auch Widerrufe bedürfen stets der gesetzlichen Form.
Was passiert, wenn man ein Testament vernichtet?
Zerstört der Erblasser ein handschriftliches Testament eigenhändig, ist keine weitere Form notwendig, denn die Handlung selbst (bei erhaltener Testierfähigkeit) bewirkt den Widerruf. Allerdings sollte die Absicht klar erkennbar sein – bestenfalls vernichtet man das Dokument vollständig.
Ein bloßes Durchstreichen oder der Vermerk „Ungültig“ auf dem Papier kann problematisch sein, sofern er nicht unterschrieben ist. Im Zweifel sollte man lieber ein offizielles Widerrufstestament erstellen, wenn man sich unsicher ist, ob die Vernichtung deutlich genug war.
Notarielle Beurkundung bei einseitigem Widerruf/Rücktritt
Sobald es um einen einseitigen Widerruf eines Ehegattentestaments oder den Rücktritt von einem Erbvertrag geht, ist immer ein Notar einzuschalten. Das Gesetz verlangt hier notarielle Beurkundung der Erklärung. Das heißt, der Widerruf bzw. Rücktritt wird in einer Niederschrift vom Notar aufgenommen und vom Erblasser (und Notar) unterschrieben.
Anschließend kümmert man sich um die Zustellung/Zugang beim anderen Beteiligten. Ohne notarielle Form ist der Vorgang nichtig – eine bloße schriftliche Mitteilung reicht nicht. Daher sollte man frühzeitig einen Notartermin vereinbaren, wenn man einen Erbvertrag kündigen oder ein gemeinsames Testament einseitig aufheben will.
Fristen und Zugang des Widerrufs einhalten
Bei einseitigen Erklärungen (Widerruf gegenüber Ehegatte, Rücktritt vom Erbvertrag) ist der Zeitpunkt des Zugangs entscheidend. Die Erklärung muss dem anderen tatsächlich zugehen, damit sie Wirksamkeit erlangt.
Man sollte dies dokumentieren, z.B. durch Zustellung per Gerichtsvollzieher oder Zustellungsurkunde. Ein Widerruf kann bis zum Zugang auch wieder zurückgenommen werden. Fristen gibt es – abgesehen von speziellen Konstellationen wie der Erbausschlagung – für Widerrufe nicht; der Erblasser kann sich Zeit lassen, sollte aber bedenken, dass im Ernstfall (z.B. bei plötzlichem Versterben) ein geplanter Widerruf ohne Zugang wirkungslos bleibt.
Was bedeutet testierfähig sein?
Wie oben erwähnt, muss der Erblasser zum Zeitpunkt des Widerrufs testierfähig sein. Außerdem sind Widerruf und Rücktritt höchstpersönliche Rechtsgeschäfte – niemand kann für den Erblasser ein Testament widerrufen oder für ihn vom Erbvertrag zurücktreten.
Eine Vertretung durch Bevollmächtigte ist hier gesetzlich ausgeschlossen (vgl. § 2064 BGB für Testamente, entsprechend für Rücktrittserklärungen).
Ist ein Notar für einen Erbvertrag notwendig?
Schon die Errichtung eines Erbvertrags erfordert notarielle Form, ebenso dessen Änderung oder Aufhebung. Man sollte also stets davon ausgehen, dass alle Erklärungen rund um den Erbvertrag (Aufhebung, Rücktritt) nur vor dem Notar wirksam vorgenommen werden können.
Materielle Bedingungen für Widerruf und Rücktritt und rechtliche Auswirkungen
Neben den formalen Aspekten stellt sich die Frage nach den materiellen Voraussetzungen, um ein Testament zu widerrufen oder von einem Erbvertrag zurückzutreten: Wann darf oder sollte man widerrufen, und was passiert danach rechtlich?
Materiell braucht ein Einzeltestament keine Gründe für den Widerruf, ein Erbvertrag sehr wohl. Rechtlich führt ein wirksamer Widerruf/Rücktritt dazu, dass alte Verfügungen aufgehoben und zukünftige Erbfolgen neu gestaltet werden können. Ungültige oder formwidrige Widerrufe hingegen haben keine Wirkung – hier drohen also große Fallstricke.
Wann darf man ein Einzeltestament widerrufen?
Hier sind keine besonderen Gründe erforderlich. Der Erblasser darf jederzeit und aus jedem Motiv sein Einzeltestament ändern oder aufheben. Das erlaubt maximale Flexibilität. Rechtliche Wirkung eines Widerrufs ist, dass das widerrufene Testament (bzw. die widerrufene Verfügung) als nicht existent betrachtet wird.
Hat der Erblasser kein neues Testament errichtet, tritt dann automatisch die gesetzliche Erbfolge ein oder es gilt ein noch früheres Testament, falls vorhanden. Hat er ein neues Testament erstellt, dann gilt dieses – das neue ersetzt das alte vollständig, sofern es ausdrücklich oder konkludent alles regelt.
Wichtig: Ein Widerruf kann sich auch auf einzelne Verfügungen beziehen, z.B. nur ein Vermächtnis widerrufen und den Rest bestehen lassen, sofern der Erblasser das so formuliert. In der Praxis wird jedoch oft das gesamte Testament erneuert.
Wann darf man gemeinsam ein Ehegattentestament widerrufen?
Materiell braucht es auch hier keinen besonderen Grund. Die Ehegatten entscheiden gemeinsam, ihren letzten Willen neu zu gestalten – vielleicht weil sich ihre Vorstellungen geändert haben. Auswirkung: Das alte gemeinschaftliche Testament wird gegenstandslos, sobald der Widerruf erfolgt ist.
Die Eheleute können entweder einen neuen gemeinschaftlichen letzten Willen verfassen oder fortan Einzeltestamente errichten. Ein kompletter Widerruf lässt sozusagen die Situation wie vor Errichtung des Ehegattentestaments entstehen. Sollte einer der Ehegatten nach dem Widerruf sterben, ohne ein neues Testament verfasst zu haben, greift die gesetzliche Erbfolge oder es gilt ein noch älteres Testament, falls vorhanden.
Wie komme ich aus dem Berliner Testament raus?
Materiell ist hier Voraussetzung, dass beide Ehepartner noch leben. Ein in Trennung befindlicher Partner kann also ohne Zustimmung des anderen den gemeinsamen letzten Willen aufkündigen. Es braucht aber keinen besonderen Sachgrund – etwa Untreue oder Ähnliches ist rechtlich nicht nötig (auch wenn es oft der Anlass ist).
Der Widerruf kann „grundlos“ erklärt werden, da jeder Erblasser die Verfügung über sein eigenes Vermögen nicht endgültig aus der Hand geben soll, solange er lebt. Rechtliche Wirkung: Die bindenden wechselbezüglichen Verfügungen des Ehegattentestaments werden mit Wirksamwerden des Widerrufs aufgehoben.
Beide Partner sind dann nicht mehr daran gebunden, einander oder bestimmte Dritte zu begünstigen. Allerdings bleibt die Vergangenheit unberührt – zum Beispiel getroffene Verfügungen zu Lebzeiten aufgrund des alten Testaments können nicht zurückgefordert werden. Nach dem Widerruf muss jeder Ehegatte, der weiterhin einen bestimmten letzten Willen umsetzen möchte, ein neues Testament errichten.
Andernfalls tritt im Todesfall die gesetzliche Erbfolge ein, da das gemeinsame Testament ja widerrufen wurde. Sollte ein Ehepartner den einseitigen Widerruf des anderen nicht akzeptieren wollen, bleibt ihm keine rechtliche Handhabe dagegen – er kann aber seinerseits nun frei testieren oder beispielsweise Scheidungsanträge weiterbetreiben etc. Wichtig: Stirbt ein Ehegatte vor Zugang einer Widerrufserklärung, kommt kein Widerruf mehr zustande, und das alte gemeinschaftliche Testament bleibt für den überlebenden bindend.
Wann kann ich von einem Erbvertrag zurücktreten?
Hier sind die materiellen Bedingungen strikt im Gesetz umrissen, wie oben dargestellt. Ohne Vorliegen eines vertraglich vereinbarten oder gesetzlich anerkannten Grundes darf der Erblasser nicht einfach zurücktreten.
Tut er es trotzdem (etwa indem er versucht, einseitig den Vertrag aufzulösen, obwohl keine Verfehlung etc. vorliegt), ist diese Erklärung unwirksam. Die rechtliche Bindung bleibt bestehen. Nur wenn eine der Voraussetzungen (§§ 2293–2295 BGB) gegeben ist, kann er wirksam zurücktreten.
Rechtliche Wirkung eines wirksamen Rücktritts: Der Erbvertrag wird mit Zugang der Rücktrittserklärung aufgelöst, als wäre er nie geschlossen worden. Die vertragsmäßigen Verfügungen, wie etwa die Erbeinsetzung des Vertragspartners, verlieren ihre Bindungswirkung. Der Erblasser kann dann frei über sein Erbe verfügen und ein anderes Testament machen.
Hat der Vertragspartner bereits Vorleistungen erbracht, z.B. Pflege geleistet oder Vermögensopfer gebracht, können ggf. Rückabwicklungsansprüche entstehen, was jedoch im Einzelfall zu prüfen ist, z.B. könnte der Pflegebedürftige verpflichtet sein, eine bereits überschiebene Immobilie zurückzuerhalten oder zu entschädigen, wenn der Vertrag aufgehoben wird – oft regeln Verträge das.
War der Rücktrittsgrund eine schwere Verfehlung, verliert der Bedachte alle Rechte aus dem Vertrag und geht leer aus – ähnlich wie bei einer Enterbung aus wichtigem Grund.
Wann wird ein Erbvertrag ungültig?
Bei beiderseitiger Aufhebung durch Vertrag ist der Effekt ebenso das Löschen der Bindungen. Beide Seiten wissen Bescheid und können neu disponieren. Hier gibt es keine „Verlierer“, da es einvernehmlich geschieht.
Kann ich mein Vermögen zu Lebzeiten verschenken?
Ein Aspekt, der oft gefragt wird: Kann der Erblasser trotz bindendem Erbvertrag oder Berliner Testament zu Lebzeiten anders verfügen, z.B. sein Vermögen verschenken? Die Bindungswirkung betrifft primär Verfügungen von Todes wegen.
Zu Lebzeiten ist der Erblasser grundsätzlich frei, mit seinem Vermögen zu machen, was er will – allerdings gibt es Grenzen, wenn er dadurch die Vertragsbindung umgehen will (Stichwort pflichtteilsschädigende Schenkungen und § 2287 BGB: der Vertragserbe könnte bei missbräuchlichen Schenkungen unter Umständen Herausgabe verlangen).
Man kann sich durch Erbvertrag oder gemeinsames Testament so binden, dass spätere Handlungen als Umgehung unwirksam oder anfechtbar sind. Ein Beispiel: Hat ein Vater sein einziges Haus vertraglich dem Sohn versprochen, kann er es nicht später einfach verschenken, um den Sohn zu benachteiligen – der Sohn könnte nach dem Tod das Geschenk vom Beschenkten zurückfordern
Welche Fehler sollte man bei Testament und Erbvertrag vermeiden?
Bei Widerruf und Rücktritt im Erbrecht passieren Laien häufig Fehler. Hier sind einige typische Fallstricke, die es zu vermeiden gilt:
Kann ein Berliner Testament durch ein neues ersetzt werden?
Viele Menschen glauben, ein späteres Einzeltestament hebe ein früheres gemeinschaftliches Testament automatisch auf. Das ist falsch, sofern es wechselbezügliche Verfügungen betrifft. Beispiel: Ehepaar hat ein Berliner Testament, Frau schreibt heimlich ein neues Testament nur für sich – dieses ist unwirksam, solange das Ehegattentestament nicht formgerecht widerrufen wurde.
Fehlervermeidung: In solchen Fällen stets den formellen Widerruf mit Notar und Zustellung durchführen, statt auf „Stillschweigen“ zu hoffen.
Kann man ein notarielles Testament durch ein handschriftliches ersetzen?
Ein häufiger Fehler ist, den Widerruf gegenüber dem Ehepartner oder den Rücktritt vom Erbvertrag nicht notariell zu erklären. Eine selbstverfasste Erklärung, ein Brief oder gar nur eine mündliche Mitteilung an den anderen genügt nicht. Wird die Form nicht eingehalten, ist der Widerruf/Rücktritt unwirksam.
Tipp: Immer an die Notariatspflicht denken und die Erklärung professionell aufsetzen lassen.
Wann ist ein Testament wirksam?
Manchmal erstellt der Erblasser zwar eine notarielle Widerrufserklärung, doch diese erreicht den anderen nicht mehr rechtzeitig, etwa weil der Ehepartner unerreichbar ist oder der Erblasser selbst verstirbt, bevor zugestellt wurde.
Ohne Zugang kein Wirksamwerden – ein trauriger Fallstrick, wenn man es zu lange hinauszögert. Daher: Widerrufs-/Rücktrittserklärungen unmittelbar nach Beurkundung zustellen lassen und nicht in der Schublade liegen lassen.
Wie kann ich mein Testament außer Kraft setzen?
Der Erblasser zerreißt sein Testament nicht vollständig oder schreibt nur „Ungültig“ darauf ohne Unterschrift. Im Nachhinein könnte Streit entstehen, ob das als Widerruf zählt, der nur mit einem Fachanwalt geklärt werden kann.
Manche Gerichte erkennen zwar ein durchgestrichenes „Ungültig“ an, aber darauf verlassen sollte man sich nicht. Vermeidung: Besser das Dokument vollständig vernichten oder ein neues Widerrufstestament errichten, statt halbe Sachen zu machen.
Ab wann ist man nicht mehr testierfähig?
Ein häufiger Problemfall in der Praxis: Ein hochbetagter oder dementer Erblasser „widerruft“ sein Testament, etwa indem er es zerreißt, ist aber eventuell gar nicht mehr testierfähig.
Dann bleibt das zerrissene Testament u.U. trotzdem gültig, was die Erben später vor Gericht beschäftigt. Merke: Bei Zweifel an der geistigen Frische im Alter sollte frühzeitig gehandelt werden. Nachträgliche Widerrufe können sonst angefochten oder verworfen werden.
Wer erbt, wenn kein Testament da ist?
Nach erfolgreichem Widerruf, besonders bei Ehegattentestamenten oder Erbvertragsrücktritt, vergessen manche Erblasser, neu zu testieren. Das kann zu einer ungewollten gesetzlichen Erbfolge führen.
Beispiel: Ehepaar widerruft gemeinsames Testament, stirbt kurz darauf ohne neue Regelung – plötzlich erben ganz andere Personen, gesetzliche Erben, evtl. entferntere Verwandte, weil keine verbindliche letztwillige Verfügung mehr existiert. Daher: Nach einem Widerruf immer unmittelbar ein neues Testament aufsetzen, damit die gewünschte Erbfolge festgelegt ist.
Kann man ein gültiges Testament anfechten?
Einige Menschen meinen, man könne ein Testament oder Erbvertrag später einfach „anfechten“, falls man es sich anders überlegt. Die Anfechtung eines Testaments ist jedoch nur bei Irrtum, Drohung oder arglistiger Täuschung bei der Errichtung möglich (§ 2078 BGB) – also in speziellen Ausnahmefällen, nicht wegen Meinungsänderung.
Ähnlich beim Erbvertrag: Anfechtung geht nur bei Irrtum oder Arglist (§ 2281 BGB), ansonsten eben Rücktritt nach obigen Regeln. Nicht verwechseln: Wer einfach nur einen anderen Willen hat als früher, muss widerrufen oder zurücktreten, nicht anfechten.
Kann man den Pflichtteil durch ein Testament ausschließen?
Wenn ein gemeinsames Testament widerrufen oder ein Erbvertrag aufgehoben wird, können Pflichtteilsrechte tangiert werden. Beispiel: Im Berliner Testament hätten die Kinder zunächst nichts bekommen – nur beim zweiten Todesfall als Schlusserben.
Widerrufen die Eltern dieses Testament, stirbt ein Elternteil, dann können die Kinder nun sofort ihren Pflichtteil verlangen. Solche Konsequenzen sollte man im Blick haben. Ggf. lässt sich das jedoch nicht vermeiden – aber man sollte die rechtlichen Auswirkungen auf Pflichtteilsansprüche kennen und planen.
Was passiert, wenn man im Trennungsjahr erbt?
Nach Scheidung werden Verfügungen zugunsten des Ex-Gatten zwar unwirksam, aber nur automatisch mit Rechtskraft der Scheidung. Stirbt einer der Ehegatten während des Scheidungsverfahrens, ist die Ehe noch nicht geschieden und ein Berliner Testament wäre weiterhin gültig – außer man hat es in weiser Voraussicht widerrufen.
Fehler: Getrennt lebende Eheleute unternehmen nichts, weil sie denken „der/die kriegt ohnehin nichts mehr“. Besser ist, bei einer Veränderung klare Verhältnisse zu schaffen, solange man es noch steuern kann.
Die genannten Fallstricke zeigen, dass bei Widerruf und Rücktritt Sorgfalt geboten ist. Im Zweifel sollte man immer fachkundigen Rat von einem Rechtsanwalt oder Notar für Erbrecht in Deutschland einholen, um Fehler zu vermeiden.
Konkrete Fallbeispiele zu Widerruf und Rücktritt aus der Praxis
Einige Beispiele sollen verdeutlichen, wie Widerruf und Rücktritt in der Praxis funktionieren und was passiert, wenn Fehler gemacht werden:
Beispiel 1: Widerruf eines Einzeltestaments
Frau Müller hat 2015 ein handschriftliches Testament geschrieben und ihren Bruder als Alleinerben eingesetzt. 2025 bekommt sie ein Kind und möchte nun dieses begünstigen. Sie entscheidet sich, ihr altes Testament zu widerrufen.
Dazu verfasst sie im April 2025 ein neues Testament, handschriftlich, mit dem Satz: „Hiermit widerrufe ich mein Testament vom 01.06.2015. Meine Tochter Lisa soll meine Alleinerbin sein.“ Sie datiert und unterschreibt das Dokument. Damit ist das Testament von 2015 aufgehoben – Frau Müller hat durch das Neue Testament den Widerruf korrekt erklärt und zugleich eine neue Erbfolge bestimmt.
Würde sie nichts Neues schreiben, könnte sie auch einfach das alte Testament vernichten. Doch mit dem neuen Testament hat sie Rechtssicherheit geschaffen. Ihr Bruder hat keinen Erbanspruch mehr (außer ggf. Pflichtteil, falls er pflichtteilsberechtigt wäre).
Beispiel 2: Ehegattentestament widerrufen bei Trennung
Peter und Marie haben als Ehepaar ein Berliner Testament (gemeinschaftliches Testament) verfasst, in dem sie sich gegenseitig zu Alleinerben und ihre gemeinsamen Kinder zu Schlusserben einsetzen. Nun trennt sich das Paar. Marie möchte verhindern, dass Peter im Fall ihres frühen Todes (vor der Scheidung) noch ihr Erbe erhält.
Sie informiert sich: Ein einfaches neues Einzeltestament von ihr würde das gemeinschaftliche Testament nicht ohne Weiteres aushebeln. Also geht Marie zum Notar und lässt eine Widerrufserklärung beurkunden. In dieser steht: „Hiermit widerrufe ich das am 10.01.2010 mit meinem Ehemann Peter errichtete gemeinschaftliche Testament.“ Der Notar lässt diese Erklärung durch einen Boten an Peter zustellen.
Peter erhält das Schriftstück und damit ist der Widerruf wirksam. Das Berliner Testament der beiden ist aufgehoben. Jeder von ihnen kann nun ein neues Testament machen. Marie schreibt gleich ein neues Testament, in dem sie ihre Kinder als Erben einsetzt. Hätte Marie den formellen Widerruf nicht durchgeführt und wäre sie z.B. bei einem Unfall ums Leben gekommen, hätte Peter noch gemäß dem alten Testament geerbt, da die Scheidung nicht rechtskräftig war – ein unerwünschtes Ergebnis, das sie nun verhindert hat.
Beispiel 3: Rücktritt vom Erbvertrag wegen Verfehlung
Herr Schubert, verwitwet, hat mit seinem einzigen Sohn einen Erbvertrag geschlossen: Der Sohn soll Alleinerbe werden, im Gegenzug versorgt er den Vater finanziell im Alter. Nach einigen Jahren kommt es zum Zerwürfnis. Der Sohn behandelt den Vater grob respektlos, verweigert ihm Unterstützung und begeht schließlich sogar eine Straftat gegen den Vater (er bedroht ihn körperlich, was angezeigt wird).
Diese schwerwiegende Verfehlung gibt Herrn Schubert das Recht, gemäß § 2294 BGB vom Erbvertrag zurückzutreten. Herr Schubert begibt sich zum Notar und erklärt dort den Rücktritt vom Erbvertrag wegen dieser Verfehlungen. Die notarielle Erklärung wird dem Sohn zugestellt. Damit ist der Erbvertrag aufgehoben – der Sohn ist nicht mehr als Erbe gebunden. Herr Schubert schreibt daraufhin ein neues Testament und setzt eine gemeinnützige Stiftung als Erbin ein.
Der Sohn hätte nun auch keinen Pflichtteilsanspruch, da das Verhalten, das zum Rücktritt berechtigte, zugleich ein Grund für Pflichtteilsentzug wäre (sofern gerichtlich festgestellt). Wäre Herr Schubert nicht formell zurückgetreten und hätte nur ein neues Testament gemacht, wäre dieses unwirksam geblieben – sein Sohn hätte trotz seines Fehlverhaltens aufgrund des Erbvertrags alles geerbt. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, die richtigen rechtlichen Schritte zu gehen.
Beispiel 4: Erbvertrag mit Pflegeverpflichtung
Frau Becker schließt mit ihrer Nichte einen Erbvertrag: Die Nichte erhält das Haus der Tante als Erbin, verpflichtet sich aber im Gegenzug, Frau Becker im Pflegefall persönlich zu betreuen. Einige Jahre später muss Frau Becker ins Pflegeheim, da die Nichte die Pflege aus beruflichen Gründen nicht übernehmen kann.
Man hebt einvernehmlich den Pflegevertrag auf. Nun liegt der Fall von § 2295 BGB vor – die Gegenverpflichtung ist entfallen. Frau Becker kann vom Erbvertrag zurücktreten. Sie erklärt den Rücktritt notariell und teilt es der Nichte mit. Die Nichte verliert damit ihren zukünftigen Erbanspruch.
Da die Beziehung aber weiterhin gut ist, setzt Frau Becker die Nichte dennoch in einem neuen (einfachen) Testament als Erbin ein, jedoch zu anderen Bedingungen und ohne die frühere Pflegeklausel. So kann flexibel reagiert werden, ohne an den ursprünglichen Vertrag gebunden zu sein.
Die Fallbeispiele machen deutlich: Je nach Konstellation sind unterschiedliche Schritte nötig, um den letzten Willen wirksam zu ändern oder aufzuheben. Nur wer die gesetzlichen Anforderungen kennt, kann unerwünschte Ergebnisse vermeiden.
Fazit und Handlungsempfehlungen zu Testament und Erbvertrag
Im Erbrecht in Deutschland haben Erblasser durchaus die Möglichkeit, ihre getroffenen Verfügungen wieder zu ändern – Testament widerrufen, Ehegattentestament aufheben oder vom Erbvertrag zurücktreten sind unter bestimmten Voraussetzungen machbar.
Entscheidend ist, bei der Vernichtung oder Veränderung die materiellen und formellen Vorgaben einzuhalten, damit der Widerruf oder Rücktritt auch wirksam ist. Ein Einzeltestament zu widerrufen ist relativ unkompliziert, während ein gemeinsames Ehegattentestament und insbesondere ein Erbvertrag einer strengeren Handhabung unterliegen.
Wird falsch vorgegangen, bleiben unerwünschte alte Regelungen bestehen oder es entsteht Rechtsunsicherheit, die einen Anwalt erfordert.
Checkliste zum Thema Widerruf und Rücktritt bei Testament und Erbvertrag
Wir haben im Folgenden eine Checkliste für Sie zusammengestellt, die die wichtigsten Punkte zum Thema Widerruf und Rücktritt bei Testament und Erbvertrag zusammenfasst.
- Regelmäßige Überprüfung: Überdenken Sie in regelmäßigen Abständen oder bei wichtigen Lebensereignissen, wie Heirat, Scheidung, Geburt von Kindern, Streit, Versöhnung, Vermögensumschichtungen, Ihre letztwilligen Verfügungen. Passen Sie Ihr Testament ggf. an oder widerrufen Sie veraltete Verfügungen, damit Ihr aktueller Wille umgesetzt wird.
- Professionelle Beratung einholen: Gerade bei komplexen Konstellationen, wie z.B. Berliner Testament widerrufen im Trennungsfall oder Erbvertrag Rücktritt, ist es ratsam, in dieser Angelegenheit einen Fachanwalt für Erbrecht oder einen Notar zu konsultieren. Anwalt und Notar kennen die Fallstricke und können dafür sorgen, dass Formvorschriften gewahrt bleiben und Ihre Erklärung gerichtsfest ist. Erbrecht ist komplex, und eine kleine Formalie kann über Wirksamkeit oder Unwirksamkeit entscheiden.
- Form einhalten: Nutzen Sie die jeweils richtige Vorgehensweise. Ein neues Testament sollte eigenhändig geschrieben und unterschrieben sein oder beim Notar errichtet werden. Vernichten Sie alte Testamente vollständig, wenn Sie sie loswerden wollen. Bei gemeinschaftlichen Testamenten: Stimmen Sie sich mit Ihrem Ehepartner ab, und wenn nicht, gehen Sie den Weg über den Notar für einen einseitigen Widerruf. Bei Erbverträgen: Prüfen Sie zunächst, ob ein vertragliches Rücktrittsrecht vereinbart ist oder ein gesetzlicher Grund vorliegt, und führen Sie den Rücktritt unbedingt notariell durch.
- Dokumentation: Heben Sie Dokumente über Widerrufe und Rücktritte gut auf. Stellen Sie bei Zustellungen sicher, dass Sie einen Nachweis haben.
- Notfallplan erstellen: Falls Sie schwer erkranken oder ins hohe Alter kommen, regeln Sie wichtige Änderungen rechtzeitig. Warten Sie nicht bis „zur letzten Minute“, denn im Falle einer plötzlichen Geschäftsunfähigkeit oder eines unerwarteten Todes könnten Ihre Änderungspläne nicht mehr greifen. Es schadet nicht, in guten Tagen bereits klar festzulegen, was mit älteren Testamenten geschehen soll.
Erbrecht: Sorgfältiges Vorgehen zahlt sich aus
Das Erbrecht bietet Ihnen die Flexibilität, auf Veränderungen zu reagieren, aber es verlangt auch, die Spielregeln genau zu beachten. Wer ein Testament widerrufen oder einen Erbvertrag aufheben will, sollte sorgfältig vorgehen.
Bei Befolgung der gesetzlichen Vorgaben kann man seinen letzten Willen jederzeit neu gestalten – Ihr letzter Wille ist nicht in Stein gemeißelt, solange Sie leben und handlungsfähig sind. Nutzen Sie diese Freiheit verantwortungsvoll, und scheuen Sie sich nicht, bei Unklarheiten Expertenrat durch Notar und Fachanwälte einzuholen. So stellen Sie sicher, dass am Ende wirklich derjenige erbt, der es nach Ihrem aktuellen Willen auch soll.