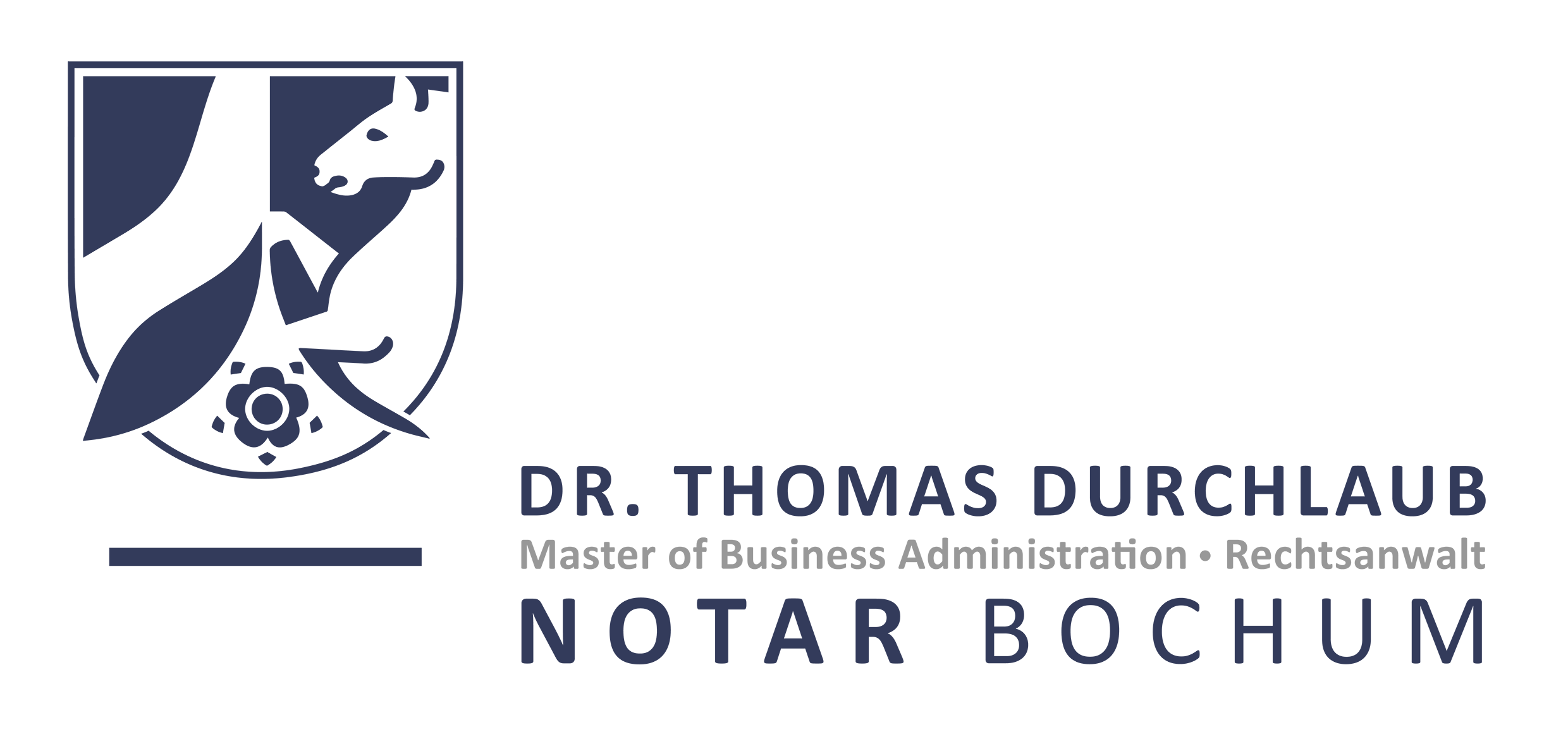Partnerschaftsvertrag – Rechtliche Klarheit
für unverheiratete Paare
In einer Partnerschaft entscheiden sich zwei Menschen bewusst füreinander – oft über viele Jahre hinweg. Gemeinsame Werte, geteilte Lebenspläne und ein vertrauensvoller Umgang bilden das Fundament. Doch was passiert, wenn sich Lebensumstände ändern – sei es durch Trennung, Krankheit oder Tod? Das deutsche Familienrecht trägt noch immer stark dem traditionellen Ehemodell Rechnung und bietet Paaren ohne Trauschein nur begrenzten rechtlichen Schutz, obwohl alternative Lebensgemeinschaften längst gesellschaftliche Realität sind. Ein Partnerschaftsvertrag bietet Ihnen die Möglichkeit, bereits im Vorfeld verbindlich und fair zu regeln, was andernfalls in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gesetzlich in der Regel unzureichend abgedeckt ist.
Rechtliche Rahmenbedingungen für unverheiratete Paare in Deutschland
Das deutsche Familienrecht orientiert sich in weiten Teilen noch immer an der klassischen Vorstellung von Ehe und Familie. Zahlreiche gesetzliche Regelungen zu Vermögen, Unterhalt oder auch elterlicher Sorge setzen eine Eheschließung als rechtliche Grundlage voraus. Zwar erkennt der Gesetzgeber ausdrücklich an, dass sich viele Paare bewusst gegen die Ehe entscheiden – dennoch bleiben ihnen die familienrechtlichen Schutzmechanismen in der Regel verwehrt. Nur in seltenen Ausnahmefällen greifen in diesem Fall bestimmte Vorschriften.
Die Folge ist eine erhebliche rechtliche Lücke: Für unverheiratete Paare existieren in zentralen Lebensbereichen – etwa bei der Vermögensaufteilung, der finanziellen Absicherung beim Hauskauf oder der Betreuung gemeinsamer Kinder – keine gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen. Gerade im Trennungsfall führt das oft zu Unsicherheiten, Konflikten und finanziellen Risiken.
Umso wichtiger ist es, dass ein Paar ohne Trauschein die gemeinsame Lebensgestaltung eigenverantwortlich in die Hand nimmt. Der Abschluss eines Partnerschaftsvertrags ist hierfür das optimale Instrument. Ein solcher Vertrag kann individuell an die Bedürfnisse der Partner angepasst werden und regelt beispielsweise Vermögensverhältnisse, finanzielle Beiträge, Wohnrechte, Unterhaltsansprüche sowie Erbfolgen. Zudem schafft ein notariell beurkundeter Vertrag zusätzliche Rechtssicherheit, da er klare Beweiskraft hat und vor Streitigkeiten schützt.
Die Erstellung eines Partnerschaftsvertrags erfolgt idealerweise gemeinsam mit einem erfahrenen Notar. Dieser berät umfassend zu den rechtlichen Möglichkeiten, klärt über Rechte und Pflichten auf und stellt sicher, dass der Vertrag rechtlich wirksam und ausgewogen ist. So können beide Partner sicher sein, dass ihre Vereinbarungen im Ernstfall Bestand haben und Konflikte vermieden werden.
Ehe und nichteheliche Lebensgemeinschaft: Keine Gleichstellung unverheirateter Paare
An die Ehe sind im deutschen Recht eine Vielzahl rechtlicher Wirkungen geknüpft – insbesondere im Familienrecht, Erbrecht und Steuerrecht. Diese umfassenden Schutz- und Ausgleichsmechanismen gelten jedoch ausschließlich für verheiratete Paare oder für gleichgeschlechtliche Paare, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) geschlossen haben.
Die eingetragene Lebenspartnerschaft, die speziell für gleichgeschlechtliche Paare geschaffen wurde, ist heute im Wesentlichen der Ehe gleichgestellt. Durch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und gesetzliche Anpassungen bestehen inzwischen weitgehend dieselben Rechte und Pflichten wie in einer Ehe – insbesondere im Hinblick auf Erbrecht, Unterhalt und Versorgungsausgleich.
Unverheiratete Paare – auch wenn sie über Jahre hinweg zusammenleben, Kinder gemeinsam großziehen oder Vermögen aufbauen – sind rechtlich nicht mit Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern gleichgestellt. Sie bilden eine sogenannte nichteheliche Lebensgemeinschaft, für die es im deutschen Recht keine eigenständige gesetzliche Regelung gibt.
Das bedeutet konkret:
- Im Erbrecht besteht kein gesetzliches Erbrecht für den Lebenspartner (§ 1931 BGB). Er kann ohne Heirat nur durch Testament oder Erbvertrag bedacht werden.
- Im Steuerrecht gelten unverheiratete Partner als fremde Dritte (§ 15 ErbStG) mit einem sehr niedrigen Erbschaftssteuerfreibetrag von lediglich 20.000 €.
- Im Familienrecht finden zentrale Mechanismen wie:
- der Zugewinnausgleich (§§ 1363 ff. BGB),
- der Versorgungsausgleich (§§ 1587 ff. BGB) sowie
- der nacheheliche Unterhalt (§§ 1570 ff. BGB) keine Anwendung auf unverheiratete Paare – weder im Todes- noch im Trennungsfall.
Ausgleichsansprüche bei unverheirateten Paaren im Falle einer Trennung
Die Trennung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft kann rechtlich sehr komplex sein, da es für unverheiratete Paare keine speziellen gesetzlichen Regelungen zu Ausgleichsansprüchen oder Aufteilung von Vermögen gibt.
Kommt es bei unverheirateten Paaren bei der Trennung zum Streit über die Eigentumsverhältnisse, greifen daher allgemeine zivilrechtliche Vorschriften, wie zur ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 812 ff. BGB) oder zur Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB). Diese Gesetze bieten zwar einen gewissen Schutz, sind aber oft nicht ausreichend, um alle Interessen der Partner fair und eindeutig zu regeln.
Ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 812 ff. BGB)
Wenn ein Partner erhebliche finanzielle Leistungen zum gemeinsamen Vermögen, wie zum Beispiel beim Immobilienkauf, beigetragen hat, ohne dass dies vertraglich geregelt wurde, können Ansprüche auf Ausgleich geltend gemacht werden. Allerdings sind diese Ansprüche oft schwer durchzusetzen und führen zu langwierigen rechtlichen Auseinandersetzungen.
Ein Partnerschaftsvertrag ermöglicht es, solche finanziellen Beiträge im Voraus zu dokumentieren und gerechte Ausgleichsmechanismen zu vereinbaren – für mehr Klarheit und Rechtssicherheit in allen Eventualitäten im Hinblick auf Eigentumsverhältnisse.
Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)
Bei Trennung kann es vorkommen, dass bestimmte Schenkungen oder Zuwendungen, die ursprünglich dem gemeinsamen Zweck dienten, ihren Sinn verlieren. In solchen Fällen kann eine Rückabwicklung von Schenkungen oder eine Anpassung der Aufteilung notwendig werden, was ohne vertragliche Grundlage zu Konflikten führen kann. Ein Partnerschaftsvertrag schafft hier die Möglichkeit, den Umgang mit solchen Situationen verbindlich zu regeln und Streit zu vermeiden.
„Der Tod eines Lebenspartners ist menschlich eine enorme Belastung. Ohne rechtliche Vorsorge kann er jedoch auch zur existenziellen Krise für den Hinterbliebenen werden. Wer nicht verheiratet ist, muss sich aktiv um rechtliche Absicherung kümmern.“ – Notar Dr. Thomas Durchlaub
Was ist ein Partnerschaftsvertrag?
Ein Partnerschaftsvertrag ist ein privatrechtlicher Vertrag, in dem nicht verheiratete Partner mit individuellen Regelungswünschen – ihre vermögensrechtlichen, unterhaltsrechtlichen oder sonstigen persönlichen Vereinbarungen verbindlich regeln. Besonders relevant ist dies beim Thema:
- Unverheiratete Paare mit gemeinsamen Kindern
- Paare mit gemeinsamen Immobilien, Unternehmen oder Vermögenswerten
- Partner mit großem Einkommens- oder Vermögensgefälle
- Menschen in Patchwork-Konstellationen oder mit Vorerbschaften
- Selbstständige, Unternehmer oder Freiberufler
Anders als bei verheirateten Paaren, bei denen gesetzliche Vorschriften (z. B. zum Güterstand oder zur Erbfolge) automatisch greifen, fehlt für nicht verheiratete Partner eine rechtliche Absicherung. Der Partnerschaftsvertrag schafft hier klare rechtliche Strukturen und schützt beide Seiten.
Welche Vorteile bietet ein Partnerschaftsvertrag?
Im Fall einer Trennung besteht ohne vertragliche Regelung keine gesetzliche Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen oder zur Vermögensaufteilung. Das kann – besonders bei gemeinsamer Immobilie, gemeinsamem Kredit für den Hauskauf oder ungleicher Einkommensverteilung – zu existenziellen Problemen führen.
Ein Partnerschaftsvertrag kann unter anderem regeln:
- Wer im Trennungsfall in der gemeinsamen Immobilie, wie einem Haus, wohnen bleibt
- Wie der Verkaufserlös der Immobilie aufgeteilt wird
- Ob einer der Partner einen Ausgleich erhält, z. B. bei Kindererziehung oder Haushaltsführung
Schutz im Todesfall
Nichteheliche Partner sind nicht automatisch erbberechtigt. Stirbt ein Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin ohne Testament, gehen der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin ohne vorherige Heirat leer aus – selbst bei jahrzehntelangem Zusammenleben.
Ein Partnerschaftsvertrag kann mit erbrechtlichen Vereinbarungen (z. B. Testament oder Erbvertrag) kombiniert werden, um diese rechtliche Lücke zu schließen.
Vermögensschutz und Transparenz
Ein Partnerschaftsvertrag regelt Besitzverhältnisse, das heißt, was beiden Partnern gemeinsam gehört – und was nicht. Die Regelung der Eigentumsverhältnisse ist besonders wichtig, wenn:
- ein Partner deutlich mehr Vermögen einbringt
- gemeinsam Immobilien, Fahrzeuge oder andere Vermögenswerte angeschafft werden
- Schulden, Kredite oder Bürgschaften im Raum stehen
Absicherung im Alltag
Auch für den Alltag bietet ein Partnerschaftsvertrag in diesem Punkt klare Regelungen, etwa:
- Wer trägt welche Kosten der Lebensführung?
- Wie werden Kinder betreut, wenn die Beziehung endet?
- Welche Vollmachten gelten im Krankheitsfall?
Ein Vertrag kann – zusätzlich zur Vorsorgevollmacht – auch Betreuungswünsche oder Regelungen für medizinische Entscheidungen enthalten.
Wie läuft die Vertragserstellung beim Notar ab?
Schritt 1: Erstgespräch & individuelle Beratung
Im persönlichen Gespräch mit Notar Dr. Thomas Durchlaub werden Ihre Ausgangssituation, Ihre Wünsche, wichtige Fragen und Ihre Ziele analysiert. Dies erfolgt beim Termin vor Ort in der Kanzlei im Exzenterhaus in Bochum.
Schritt 2: Entwurf des Vertrags
Auf Basis des Gesprächs erstellt der Notar einen individuellen Entwurf, der rechtlich alle wesentlichen Aspekte und Details berücksichtigt und Ihre Interessen widerspiegelt.
Schritt 3: Prüfung & Anpassung
Sie erhalten ausreichend Zeit, den Entwurf zu prüfen – gerne gemeinsam mit einer Vertrauensperson. Änderungswünsche oder Ergänzungen werden berücksichtigt und in eine finale Fassung überführt.
Schritt 4: Notarielle Beurkundung
Die notarielle Beurkundung verleiht dem Vertrag seine rechtliche Wirksamkeit. Sie stellt sicher, dass beide Parteien über ihre Rechte und Pflichten informiert sind und der Vertrag vor Gericht Bestand hat.
Schritt 5: Archivierung & sichere Aufbewahrung
Ihr Vertrag wird im zentralen Urkundenverzeichnis der Bundesnotarkammer erfasst und auf Wunsch in der Kanzlei dauerhaft archiviert. So ist er im Bedarfsfall jederzeit auffindbar.
Fazit: Absicherung erfordert rechtzeitiges Handeln
Im Fall von Trennung, Krankheit oder Tod kann die fehlende gesetzliche Absicherung für unverheiratete Paare zu existenzbedrohenden Konsequenzen führen – etwa wenn der überlebende Partner keinen Anspruch auf das Erbe hat, aus der gemeinsamen Immobilie ausziehen muss oder keinen Zugriff auf Konten oder Unterlagen bekommt.
Da das Gesetz bei unverheirateten Paaren keine umfassenden Ausgleichs- oder Vermögensregelungen vorsieht, ist ein individuell gestalteter Partnerschaftsvertrag das effektivste Mittel, um im Falle einer Trennung oder im Fall des Todes klare Verhältnisse zu schaffen.
Er regelt nicht nur die Aufteilung von Vermögenswerten und etwaige Ausgleichsansprüche, sondern schafft auch eine verlässliche Grundlage für den gemeinsamen Alltag – vom finanziellen Beitrag, über Unterhaltsansprüche und Betreuung der Kinder bis hin zu Wohn- und Nutzungsrechten einer Immobilie, wie Haus oder Wohnung.
Ergänzend dazu kann der Vertrag mit weiteren notariellen Regelungen kombiniert werden, etwa mit einem Testament, einem Wohnrecht im Grundbuch, einer Vorsorgevollmacht oder einer Lebensversicherung mit Bezugsrecht. So entsteht ein rechtlich stimmiges Gesamtkonzept, das beiden Partnern Sicherheit und Verlässlichkeit gibt.
Ohne eine solche vertragliche Grundlage riskieren unverheiratete Paare im Ernstfall den vollständigen Verlust von Rechten – etwa dann, wenn beim Tod des Partners gesetzliche Erben eintreten oder bei Trennung keine Ausgleichsansprüche bestehen. Ein Partnerschaftsvertrag sorgt dafür, dass nicht Gerichte oder gesetzliche Lücken entscheiden, sondern Ihre eigenen Vereinbarungen.
FAQ – Häufige Fragen zum Partnerschaftsvertrag
Was passiert, wenn mein Partner stirbt und wir nicht verheiratet sind?
Wenn Ihr Partner stirbt und Sie nicht verheiratet sind, haben Lebensgefährten ohne testamentarische oder vertragliche Regelungen keinerlei gesetzlichen Anspruch auf das Erbe. Das bedeutet:
- Lebensgefährten erben nichts vom Partner – weder Immobilie noch Vermögen, es sei denn, Sie wurden im Testament ausdrücklich als Erbe eingesetzt.
- Pflichtteilsansprüche bestehen nicht, da diese nahen Verwandten und Ehegatten zustehen.
- Sie haben kein Wohnrecht für Haus oder Wohnung, selbst wenn Sie gemeinsam in der Immobilie gelebt haben, sofern diese nicht auch auf Ihren Namen im Grundbuch eingetragen ist.
- Ohne Vorsorgevollmacht dürfen Sie weder Entscheidungen im medizinischen Notfall treffen, noch Behörden- oder Bankgeschäfte des Partners übernehmen.
Ist ein Partnerschaftsvertrag ohne Notar gültig?
Grundsätzlich ja – ein Partnerschaftsvertrag kann formfrei, also ohne Notar, geschlossen werden. Allerdings entfalten bestimmte Regelungen nur dann volle rechtliche Wirkung, wenn sie notariell beurkundet wurden.
Ein Notar sorgt zudem dafür, dass beide Partner über ihre Rechte und Pflichten umfassend informiert sind und der Vertrag neutral, fair und rechtlich korrekt ausgestaltet wird.
Ein schriftlicher Vertrag nach Muster ohne Notar kann wirksam sein, ist aber rechtlich riskant und oft lückenhaft. Für Rechtssicherheit, Wirksamkeit und Schutz beider Parteien ist die notarielle Beurkundung dringend zu empfehlen.
Wann ist ein Partnerschaftsvertrag sinnvoll?
Ein Partnerschaftsvertrag ist für ein unverheiratetes Paar immer dann sinnvoll, wenn Partner ihr rechtliches, wirtschaftliches und finanzielles Verhältnis klar regeln und sich gegenseitig absichern möchten – insbesondere, wenn sie nicht verheiratet sind.
- Bei gemeinsamem Vermögen, z. B. Immobilie, Konten oder anderen Vermögenswerten
- Wenn ein Partner deutlich mehr Geld oder Eigentum einbringt
- Bei gemeinsamer Kindererziehung ohne Trauschein
- Zur Regelung von Unterhalt, z. B. bei Karriereverzicht eines Partners
- Für den Fall einer Trennung oder eines Todesfalls
- Wenn ein Partner selbstständig oder Unternehmer ist
Wie viel kostet ein Partnerschaftsvertrag beim Notar?
Die Kosten für einen Partnerschaftsvertrag beim Notar richten sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) und hängen vom Vermögenswert der Beteiligten ab. Es handelt sich um gesetzlich festgelegte Gebühren, die deutschlandweit einheitlich sind. Eine exakte Berechnung erfolgt im Vorfeld auf Grundlage Ihrer Angaben. Rufen Sie für einen individuellen Termin gerne an oder schreiben Sie eine Nachricht.
Wie sollten sich unverheiratete Paare absichern?
Unverheiratete Paare haben keinen gesetzlichen Schutz – weder bei Trennung noch im Todesfall. Eine Garantie für Liebe gibt es nicht. Um rechtliche Nachteile zu vermeiden, sollten Sie sich durch vertragliche und notarielle Regelungen absichern.
Wichtigste empfohlene Maßnahmen für eine solche Situation:
- Partnerschaftsvertrag Individuelle Regelungen zu Vermögen, Schulden, Unterhalt, Kinderbetreuung, Immobilieneigentum im Falle von Trennung oder Todesfall.
- Gemeinsames Testament oder Erbvertrag Absicherung im Todesfall – da Lebensgefährten gesetzlich nicht erbberechtigt sind.
- Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung Damit sich Partner im Krankheitsfall rechtswirksam vertreten dürfen (z. B. gegenüber Ärzten, Banken, Behörden).
- Regelungen zur Altersvorsorge Private Vereinbarungen über Versorgungsleistungen oder Rentenausgleich bei Karriereverzicht.
Wie kann man den Partner absichern, wenn man nicht verheiratet ist?
Ohne Trauschein besteht kein gesetzliches Erbrecht, kein Unterhaltsanspruch und keine automatische Vertretungsbefugnis im medizinischen Notfall. Wer seinen Partner absichern möchte, muss bei diesem Thema aktiv werden – durch rechtlich verbindliche Verträge und Vollmachten.
Empfohlene Schritte, um alles rechtssicher zu gestalten:
- Testament oder Erbvertrag beim Notar Lebenspartner können sich gegenseitig als Erben einsetzen – dies ist allerdings nur mit notarieller Beurkundung eindeutig und rechtswirksam.
- Partnerschaftsvertrag Klare Regelung zu Eigentum, Kostenverteilung, Unterhalt, Trennung und Vorsorge.
- Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung Damit der Partner bei Unfall, Krankheit oder Demenz rechtlich handlungsfähig bleibt.
Ist es möglich, einen Lebenspartner ohne gemeinsamen Wohnsitz zu haben?
Ja – ein gemeinsamer Wohnsitz ist keine Voraussetzung für eine Partnerschaft oder deren rechtliche Absicherung. Lebenspartnerschaften oder nichteheliche Lebensgemeinschaften können auch mit getrennten Haushalten bestehen. Entscheidend ist die gegenseitige emotionale, wirtschaftliche oder fürsorgliche Bindung.
Ein Partnerschaftsvertrag kann also auch dann geschlossen werden, wenn beide Partner in einer Beziehung sind und getrennt wohnen – etwa aus beruflichen, finanziellen oder persönlichen Gründen. Ebenso gelten die Empfehlungen zu Testament, Vollmacht und Absicherung unabhängig vom Wohnort.