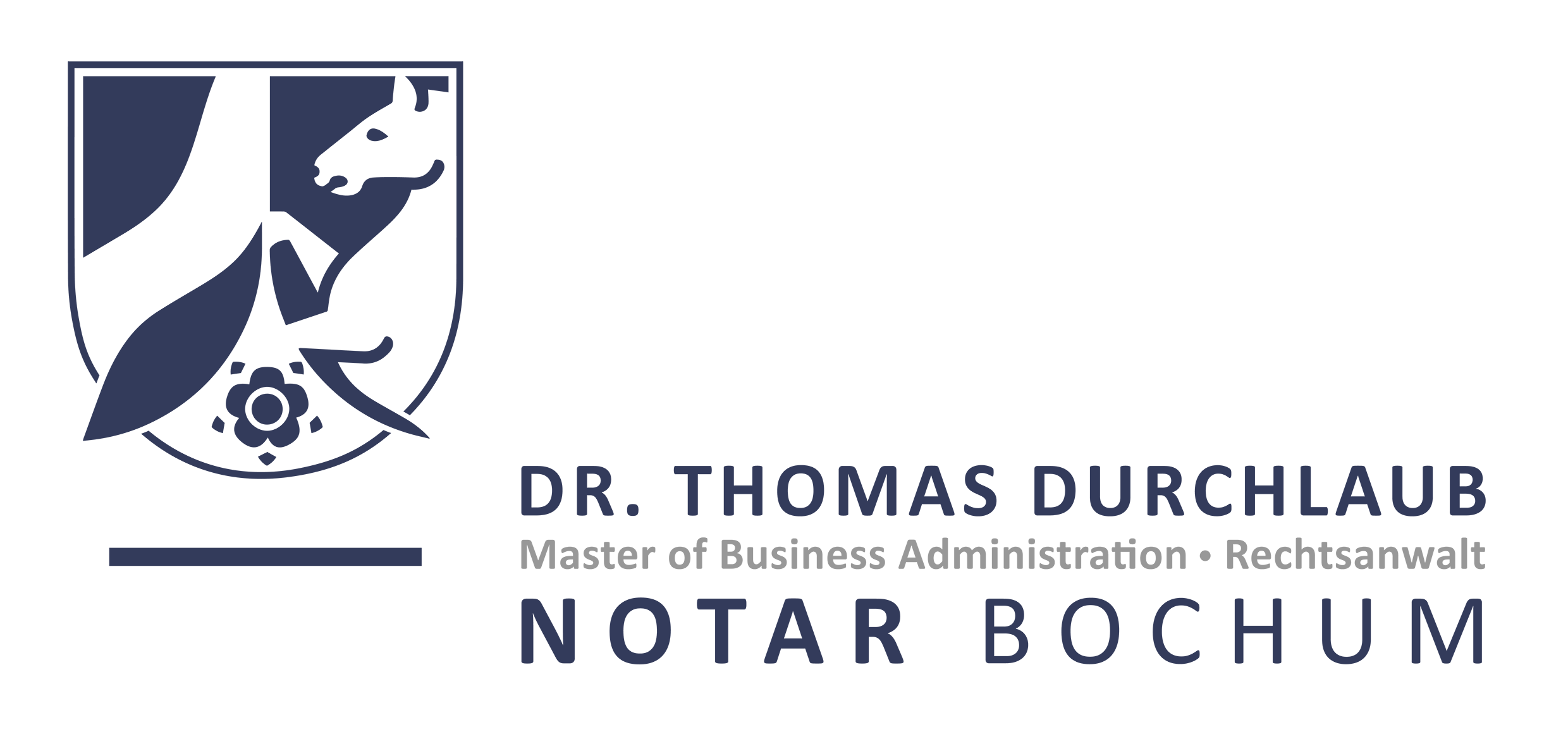Teilungserklärung Notar, Kosten und wichtige Hinweise
Die Teilungserklärung ist ein zentrales Dokument, wenn ein Gebäude in einzelne Eigentumseinheiten – beispielsweise Wohnungen oder Gewerbeeinheiten – aufgeteilt werden soll. Sie regelt die rechtlichen Verhältnisse zwischen den Miteigentümern und legt genau fest, welche Räume zum Sondereigentum und welche zum Gemeinschaftseigentum gehören. Um rechtlich wirksam zu sein, wird die Erstellung notariell beurkundet, daher geht sie auch mit Kosten und Gebühren einher. Erst durch diesen Schritt wird die Teilung rechtlich wirksam und ermöglicht den Verkauf oder die separate Nutzung einzelner Einheiten.
Teilungserklärung für Eigentumswohnungen – Voraussetzungen, Vorteile & Gestaltung
Die Teilungserklärung ist ein zentrales Dokument im Wohnungseigentumsrecht (WEG-Recht) und bildet die Grundlage, um aus einem Gebäude einzelne Eigentumswohnungen zu begründen. Damit können Eigentümer, Bauträger oder Kapitalanleger ein Grundstück rechtlich in Wohnungseigentum aufteilen und so jede Wohnung einzeln verkaufen oder beleihen.
Für Wohnungseigentümergemeinschaften regelt die Teilungserklärung das Miteinander der Eigentümer und schafft klare Verhältnisse. In diesem Blogbeitrag erläutern wir – juristisch präzise, aber allgemein verständlich – was eine Teilungserklärung nach dem Wohnungseigentumsgesetz ist, welche Vorteile eine rechtssichere Teilungserklärung bietet, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wie man sie gestalten kann, typische Fehler, den Ablauf der Erstellung sowie die anfallenden Kosten. So erhalten Eigentümer, Bauträger, Kapitalanleger, Immobilienverwalter und auch Rechtsanwälte ohne spezielles WEG-Wissen einen umfassenden Leitfaden zu diesem Thema.
Rechtlicher Hintergrund: Teilungserklärung nach dem Wohnungseigentumsgesetz
Rechtlich basiert die Teilungserklärung auf § 8 des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG), der es einem Alleineigentümer ermöglicht, sein Grundstück in Wohnungs- bzw. Teileigentum aufzuteilen. Konkret erklärt der Eigentümer gegenüber dem Grundbuchamt, dass das Grundstück in Miteigentumsanteile mit Sondereigentum (den einzelnen Wohnungen) aufgeteilt wird.
Sondereigentum ist ein zentraler Begriff im Wohnungseigentumsrecht (§ 1 WEG – Wohnungseigentumsgesetz) und beschreibt das alleinige Eigentum an bestimmten, abgeschlossenen Räumen innerhalb eines gemeinschaftlichen Gebäudes – typischerweise an einer Wohnung oder einem Gewerberaum (in diesem Fall handelt es sich dann nicht um Wohnungseigentum, sondern um sog. Teileigentum).
Das heißt: der jeweilige Eigentümer ist verantwortlich, während bei Gemeinschaftseigentum die Zustimmung der Eigentümerversammlung nötig ist, um Veränderungen durchzuführen, wie zum Beispiel die Gestalt des Balkons baulich zu verändern.
Die Erklärung muss notariell erfolgen – eine Beurkundung durch den Notar ist gesetzlich Pflicht, damit für jede Wohnung ein eigener Grundbucheintrag angelegt werden kann. In der Praxis wird die Teilungserklärung daher von einem Notar beurkundet und anschließend im Grundbuch vollzogen.
Was ist eine Teilungserklärung?
Durch die Teilungserklärung entsteht untrennbar verbundenes Eigentum: zum einen Miteigentum am Gemeinschaftseigentum (dem Grundstück und den gemeinschaftlichen Gebäudeteilen wie z.B. Dach, Treppenhaus, Fassade), zum anderen Sondereigentum an der jeweiligen abgeschlossenen Wohnung selbst. Die Teilungserklärung grenzt Sonder- und Gemeinschaftseigentum klar voneinander ab.
Die Summe aller Miteigentumsanteile beträgt 1/1, und jedem Anteil ist genau eine Wohnung als Sondereigentum zugeordnet. Das Gemeinschaftseigentum gehört allen Wohnungseigentümern gemeinsam im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile, welche meist in Bruchteilen (z.B. in Tausendstel) angegeben werden. Diese Anteile bilden auch den Maßstab für Stimmrechte und Kostenverteilung, sofern in der Teilungserklärung nichts Abweichendes geregelt ist.
Ein wichtiger Unterschied: Gemeinschaftsordnung vs. Teilungserklärung
Oft enthält oder begleitet die Teilungserklärung eine Gemeinschaftsordnung. Die Gemeinschaftsordnung ist das interne Regelwerk der Wohnungseigentümergemeinschaft, bestimmt die Rechte und Pflichten und regelt so das Verhältnis der Eigentümer untereinander. Sie legt zum Beispiel fest, welche Regeln für Fahrzeuge, die auf dem gemeinsamen Grundstück stehen, gelten.
Wichtig ist der Unterschied: Die Teilungserklärung begründet das Wohnungseigentum, teilt also das Eigentum am Gebäude rechtlich auf, während die Gemeinschaftsordnung Details der Verwaltung und des Zusammenlebens regelt (etwa Nutzungsregeln, Stimmrecht, Kostenverteilung im Detail etc.). In vielen Fällen verwaltet eine Hausverwaltung das gemeinschaftliche Eigentum einer Wohnanlage und besitzt eine Kopie der Teilungserklärung.
Eine Gemeinschaftsordnung ist gesetzlich nicht zwingend erforderlich für die Entstehung von Wohnungseigentum – fehlt sie, gelten automatisch die Bestimmungen des WEG. In der Praxis wird jedoch empfohlen, eine Gemeinschaftsordnung als Teil der Teilungserklärung aufzusetzen, um Regelungsbedarfe konkret auf die Gemeinschaft zuzuschneiden.
Änderungen an der Gemeinschaftsordnung oder Teilungserklärung sind nach Eintragung nur einstimmig (Zustimmung der anderen Miteigentümer) und wiederum notariell möglich, was ihre Beständigkeit unterstreicht.
Alle im Rahmen der Teilungserklärung eingereichten Dokumente werden vom Grundbuchamt verwahrt. Die Teilungserklärung samt Gemeinschaftsordnung ist für alle aktuellen und zukünftigen Wohnungseigentümer verbindlich und kann von Dritten mit berechtigtem Interesse – etwa Kaufinteressenten – im Grundbuch eingesehen werden. Bei Bedarf kann man beim zuständigen Grundbuchamt eine Abschrift anfordern. Kaufinteressenten sollten die Teilungserklärung sorgfältig prüfen, da sie wie eine „Verfassung“ der Eigentümergemeinschaft wirkt und wichtige Regeln (z.B. zur Nutzung der Wohnung oder Kostenpflichten) vorgibt.
Woraus besteht eine Teilungserklärung?
Die ca. 20 bis 40 Seiten umfassende Teilungserklärung besteht aus mehreren Teilen:
- Aufteilungsplan
- Zeichnerische Darstellung des Gebäudes (Grundrisse, Ansichten, Schnitte).
- Kennzeichnung der einzelnen Wohnungen und/oder Teileigentumseinheiten (z. B. Kellerräume, Garagen).
- Notarielle Beglaubigung ist erforderlich.
- Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Von der Baubehörde ausgestellt.
- Bestätigung, dass die Einheiten in sich abgeschlossen sind (z. B. durch eigene Eingänge, Sanitäreinrichtungen).
- Voraussetzung für die Eintragung ins Grundbuch.
- Textliche Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung
- Legt die rechtlichen Verhältnisse zwischen den Eigentümern fest.
- Wichtige Inhalte:
- Zuweisung von Sonder- und Gemeinschaftseigentum.
- Nutzungsregelungen (z. B. wer darf was wie nutzen?).
- Kostenverteilung (z. B. nach Miteigentumsanteilen).
- Stimmrechte und Beschlussfassungen.
- Hausordnung, ggf. Regelungen zu Tierhaltung, Renovierungen, etc.
- Regelungen zur Verwaltung (z. B. Bestellung eines Verwalters).
Vorteile einer klaren und rechtssicheren Teilungserklärung
Eine klare und rechtssichere Teilungserklärung bietet zahlreiche Vorteile für alle Beteiligten der Wohnungseigentümergemeinschaft:
- Rechtssicherheit und klare Zuordnung: Die Teilungserklärung legt eindeutig fest, welche Bereiche des Hauses als Sondereigentum eingestuft werden und welche zum gemeinsamen Eigentum, wie Treppen oder Dach. Jeder Eigentümer weiß genau, worüber er allein verfügen kann und wo Abstimmung mit den Miteigentümern nötig ist. Dadurch werden Missverständnisse vermieden, etwa wer für die Reparatur eines bestimmten Gebäudeteils zuständig oder kostenpflichtig ist, die der Haus- oder Wohnungseigentümer mitbesitzt. Klare Regelungen (z.B. welche Teile eines Balkons privat oder gemeinschaftlich sind) verhindern spätere Streitigkeiten.
- Konfliktarmes Miteinander: Eine umfassende Teilungserklärung (inkl. Gemeinschaftsordnung) enthält alle wichtigen Spielregeln für das Zusammenleben der Eigentümer. Sie regelt Nutzungsrechte, Hausordnung, Stimmrechte und Kostenverteilung so, dass ein möglichst konfliktfreies Miteinander gewährleistet ist. Zum Beispiel können in der Gemeinschaftsordnung Regeln zur Tierhaltung oder zur Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen festgelegt werden, die potentiellen Konfliktstoff von vornherein entschärfen. Je klarer diese Vereinbarungen, desto weniger Anlass zu Auseinandersetzungen gibt es später in Eigentümerversammlungen.
- Grundlage für Verkauf und Finanzierung: Ohne gültige Teilungserklärung lässt sich keine Eigentumswohnung einzeln verkaufen oder beleihen. Erst die Teilungserklärung schafft die Voraussetzung für eigene Grundbucheinträge der Wohnungen und damit für den Verkauf einzelner Einheiten. Für Banken ist eine notariell beurkundete Teilungserklärung zudem unerlässlich, um eine Immobilienfinanzierung für eine einzelne Wohnung zu gewähren. Käufer und Kreditgeber erhalten durch das Dokument die notwendige Sicherheit über den Rechtsstatus der Wohnung.
- Wertsteigerung und Investitionsvorteile: Durch die Aufteilung in Eigentumswohnungen wird Immobilieneigentum flexibler und oft wertvoller. Bauträger und Kapitalanleger können ein Mehrfamilienhaus in einzelne Wohnungen aufteilen und diese getrennt veräußern – häufig lässt sich so ein höherer Gesamterlös erzielen, als wenn das Haus nur im Ganzen verkauft würde. Zudem ermöglicht die Aufteilung die getrennte Beleihung der Wohnungen (Eintragung individueller Grundschulden), was Finanzierungsmöglichkeiten verbessert. Auch für Eigentümer kann es attraktiv sein, Teile ihres Gebäudes (z.B. eine Einliegerwohnung) als separate Eigentumswohnung auszuweisen und zu verkaufen oder zu vermieten.
- Strukturierte Verwaltung und Vorsorge: Eine durchdachte Teilungserklärung erleichtert die Verwaltung der Wohnanlage. Pflichten der Eigentümer und des Verwalters sind klar verteilt, was die Hausverwaltung effizienter macht. Zudem können in der Teilungserklärung oder Gemeinschaftsordnung Vorkehrungen getroffen werden, um künftige Entwicklungen zu bewältigen – etwa Öffnungsklauseln (siehe unten) für flexible Anpassungen oder Vereinbarungen über Instandhaltungsrücklagen. All dies trägt zur langfristigen Stabilität und Attraktivität der Wohnanlage bei.
Zusammengefasst schafft eine gute Teilungserklärung Rechtssicherheit, verringert Konfliktpotential und erhöht die Nutz- und Verwertbarkeit der Immobilie. Sie ist damit ein wichtiges Instrument, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden und den Wert der Eigentumswohnungen zu sichern.
Voraussetzungen für die Errichtung einer Teilungserklärung
Um eine Teilungserklärung wirksam erstellen zu können, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Im Folgenden eine Übersicht der wichtigsten Punkte – gewissermaßen eine Checkliste, was Sie benötigen, um Wohnungseigentum nach WEG zu begründen:
Alleineigentum oder Zustimmung aller Eigentümer
Derjenige, der die Teilungserklärung abgibt, muss verfügungsberechtigt am Grundstück sein. Im Regelfall ist dies der Alleineigentümer. Sind bereits mehrere Personen als Eigentümer im Grundbuch eingetragen (Miteigentümer), können sie nur gemeinschaftlich durch notarielle Vereinbarung nach § 3 WEG aufteilen.
Ohne Zustimmung aller Miteigentümer ist die Aufteilung nicht möglich. Praktisch bedeutet dies: Bevor eine Immobilie aufgeteilt werden kann, muss Klarheit über die Eigentumsverhältnisse bestehen (ggf. müssen erst Miteigentumsanteile in einer Gemeinschaft geklärt oder auf einen Eigentümer übertragen werden).
Abgeschlossenheit der Wohnungen
Eine grundlegende Voraussetzung ist, dass die aufzuteilenden Einheiten baulich in sich abgeschlossen sind. Sollen beispielsweise zwei Wohnungen zusammengelegt oder getrennt werden, muss jede Wohnung bautechnisch getrennt und unabhängig nutzbar sein – typischerweise mit eigenen Wänden/Decken, eigenem Eingang und grundlegender Ausstattung (z.B. Küche, Sanitärbereich).
Der Nachweis erfolgt über die Abgeschlossenheitsbescheinigung der Baubehörde. Diese Bescheinigung bestätigt, dass alle Wohneinheiten den bauordnungsrechtlichen Anforderungen genügen und als separate Einheiten abgeschlossen sind.
Wichtig: Ohne Abgeschlossenheitsbescheinigung ist eine Eintragung der Wohnungsrechte ins Grundbuch nicht möglich – sie ist zwingende Voraussetzung für den Vollzug der Teilung. Die Bescheinigung wird auf Basis von Bauplänen vom örtlichen Bauamt oder der Bauaufsichtsbehörde ausgestellt und ggf. durch Siegel auf den Plänen dokumentiert. Planen Sie daher ausreichend Zeit ein, um diese behördliche Bestätigung einzuholen.
Aufteilungsplan (Bauzeichnungen)
Ebenfalls erforderlich ist ein Aufteilungsplan, der die geplante Aufteilung des Gebäudes grafisch darstellt. Dabei handelt es sich um maßstabgerechte Bauzeichnungen (Grundrisse aller Etagen, Ansichten, Schnitte), in denen jede einzelne Einheit mit einer Nummer gekennzeichnet ist und die Trennung von Sonder- und Gemeinschaftseigentum ersichtlich wird.
In der Regel erstellt ein Architekt oder Ingenieur diese Pläne. Sie müssen von der Baubehörde geprüft und genehmigt werden (oft erfolgt dies im Zuge der Abgeschlossenheitsbescheinigung, die den Plänen beigefügt wird). Der Aufteilungsplan stellt sicher, dass die Grenzen des Sondereigentums eindeutig festgelegt sind – er wird daher als „zeichnerischer Bestandteil“ der Teilungserklärung beim Grundbuch eingereicht.
Praktisch sollten im Aufteilungsplan alle Räume, die zu einer Wohnung gehören, die gleiche Nummer tragen und farblich oder durch Schraffur abgegrenzt sein. Auch gemeinschaftliche Bereiche können markiert werden. Außerdem wird meist die Größe der jeweiligen Wohnungen und der Miteigentumsanteil (z.B. in /1000) aus dem Aufteilungsplan bzw. der Teilungserklärung ersichtlich gemacht.
Baugenehmigung / baulicher Zustand
Die Immobilie sollte genehmigt und fertiggestellt (oder fertig planbar) sein. Für ein bereits bestehendes Gebäude setzt die Abgeschlossenheitsbescheinigung voraus, dass alle Bauarbeiten abgeschlossen sind bzw. dem genehmigten Zustand entsprechen.
Bei einem Neubau kann die Teilungserklärung auch schon vor Fertigstellung abgegeben werden (sog. Vorratsteilung), sofern auf den genehmigten Bauplänen basierende Aufteilungspläne und eine vorläufige Abgeschlossenheitsbescheinigung vorliegen. In jedem Fall muss die baurechtliche Zulässigkeit der Aufteilung gegeben sein.
Hinweis: In manchen Gemeinden gelten Umwandlungsbeschränkungen, z.B. in Milieuschutzgebieten. Dort bedarf die Aufteilung eines Mietshauses in Eigentumswohnungen einer zusätzlichen Genehmigung nach BauGB. Dies sollten Eigentümer im Vorfeld prüfen, um keine rechtlichen Hindernisse zu übersehen.
Ggf. weitere Unterlagen und Zustimmungen
Falls Belastungen auf dem Grundstück liegen (Grundschulden, Hypotheken), ist abzuklären, wie diese auf die neuen Wohnungsgrundbücher übertragen werden. Meist stimmen die Gläubigerbanken der Aufteilung zu, da dadurch die Sicherheit meist werthaltiger wird (einzelne Wohnungen können als Sicherheit dienen).
Dies erfolgt über den Notar. Sollten Mieter in den Wohnungen leben, müssen zwar diese der Aufteilung an sich nicht zustimmen, aber es greifen besondere mietrechtliche Regelungen (z.B. Umwandlungsschutz: nach Aufteilung verlängert sich die Kündigungssperrfrist bei Eigenbedarf auf bis zu 10 Jahre je nach Region). Diese Punkte betreffen zwar nicht die Wirksamkeit der Teilungserklärung, sollten jedoch im Prozess bedacht werden.
Kann ich eine Teilungserklärung selbst erstellen?
Die Teilungserklärung muss notariell beurkundet werden. Praktisch bedeutet dies, dass Sie einen Notar einschalten müssen, der die Erklärung vorbereitet oder prüft und beurkundet.
Ohne Notar geht es nicht: Das Grundbuchamt akzeptiert die Teilungserklärung nur mit notarieller Mitwirkung. Üblicherweise wird gleich eine notarielle Beurkundung vorgenommen, bei der der Notar den gesamten Text der Teilungserklärung aufnimmt und alle Beteiligten (hier meist nur der teilende Eigentümer) die Urkunde beim Notar unterzeichnen.
Eine einfache Unterschriftsbeglaubigung wäre zwar in manchen Fällen theoretisch ausreichend, doch verlangen Grundbuchämter für die Eintragung des Wohnungseigentums meist die förmliche Beurkundung. Planen Sie also einen Notartermin ein.
Was benötigt der Notar für eine Teilungserklärung?
Eine notariell beurkundete Teilungserklärung benötigt man, wenn ein Grundstück oder Gebäude in Wohnungs- oder Teileigentum aufgeteilt werden soll – also zur rechtlichen Begründung von Eigentumswohnungen oder gewerblichen Teileinheiten. Für die Erstellung der Teilungserklärung ist in der Praxis folgendes erforderlich:
- Grundbuchauszug
- genehmigte Baupläne als Aufteilungsplan
- Abgeschlossenheitsbescheinigung vom Bauamt
- Notar für die Beurkundung
– und natürlich den Willen bzw. Beschluss des Eigentümers (oder aller Miteigentümer) zur Aufteilung. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, steht dem Erlass der Teilungserklärung nichts mehr im Wege.
Gestaltungsmöglichkeiten der Teilungserklärung
Innerhalb der gesetzlichen Vorgaben bietet eine Teilungserklärung vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, um die Eigentumsverhältnisse und Regeln genau an die Immobilie und die Vorstellungen der Eigentümer anzupassen. Hier einige wichtige Inhalte, Kosten und Streitfälle, die im Rahmen der Teilungserklärung (inkl. Gemeinschaftsordnung) geregelt werden können:
Aufteilung in Sonder- und Gemeinschaftseigentum
Zunächst definiert die Teilungserklärung, welche Bestandteile des Gebäudes zum Sondereigentum der jeweiligen Wohnung gehören und welche Teile des Hauses gemeinschaftliches Eigentum darstellen und zwingend oder per Vereinbarung Gemeinschaftseigentum bleiben. Das Gesetz legt fest, dass tragende Teile des Gebäudes, die Außenhülle (Dach, Außenwände) und alle Anlagen, die mehreren Wohnungen dienen (Heizung, Leitungen etc.), Gemeinschaftseigentum sind. Hier ist bei Veränderungen die Zustimmung aller Miteigentümer nötig.
Innenräume und nicht tragende Wände innerhalb der Wohnung sind Sondereigentum. Allerdings gibt es Grenzfälle – z.B. Fenster, Balkone oder Terrassen. Hier kann die Teilungserklärung klarstellen, wie diese einzuordnen sind: Balkone, Fenster und Fensterrahmen gehören zum Gemeinschaftseigentum, aber der Bodenbelag und Innenanstrich können zum Sondereigentum erklärt werden.
Solche Klarstellungen sind wichtig, um spätere Unklarheiten zu vermeiden. Während beim Sondereigentum der jeweilige Eigentümer die Kosten allein trägt, werden Kosten beim Gemeinschaftseigentum aufgeteilt. Auch Freiflächen wie Gartenanteile oder Stellplätze können seit der WEG-Reform 2020 teils als Sondereigentum ausgewiesen werden, sofern ihre Lage im Plan genau vermasst ist, oder alternativ als Gemeinschaftseigentum mit Sondernutzungsrecht (siehe nächster Punkt).
Sondernutzungsrechte festlegen
Nicht alle Bereiche lassen sich als Sondereigentum zuordnen (weil sie z.B. konstruktiv Gemeinschaftseigentum sind). Dennoch kann man bestimmten Eigentümern ein exklusives Nutzungsrecht an Teilen des Gemeinschaftseigentums einräumen – das sind Sondernutzungsrechte.
Typische Beispiele:
- alleinige Gartennutzung für die Erdgeschosswohnung
- Sondernutzungsrecht an einem bestimmten Kfz-Stellplatz
- alleiniges Nutzungsrecht an einem Kellerraum oder Dachbodenanteil.
In der Teilungserklärung wird genau beschrieben, welcher Eigentümer welches Sondernutzungsrecht erhält. Damit wird wirtschaftlich eine ähnliche Stellung wie Sondereigentum erreicht, obwohl das Grundstück rechtlich nicht getrennt wird und die Fläche im rechtlichen Eigentum aller verbleibt.
Eine eindeutige Formulierung ist hier wichtig, damit keine Überschneidungen entstehen und alle Eigentümer ihre Rechte gemäß. der Teilungserklärung kennen. Sondernutzungsrechte erhöhen oft den Wert einzelner Wohnungen (z.B. „mit Stellplatz“), müssen aber eindeutig zugeordnet sein.
Höhe der Miteigentumsanteile und Stimmrechte
Der Aufteilungsplan und die Teilungserklärung legen den Bruchteil fest, der jedem Wohnungseigentum am Gesamtgrundstück zugeordnet wird (oft im Verhältnis zur Wohnungsgröße). Üblich sind z.B. Aufteilungen in Tausendstel.
Diese Miteigentumsanteile (MEA) bestimmen in vielen Fällen die Stimmrechte und die Verteilung der Kosten. Standard ist zwar „ein Kopf, eine Stimme“ in der Eigentümerversammlung, doch kann in der Gemeinschaftsordnung vereinbart werden, dass im Verhältnis der MEA oder nach Anzahl der Wohnungen pro Eigentümer abgestimmt wird. Je mehr Wohnungen die Eigentümer besitzen desto mehr Stimmrechte haben sie in diesem Fall.
Ebenso kann man Mehrstimmrechte für große Einheiten vorsehen oder bestimmte Beschlussgegenstände an die Wertquote knüpfen. Die Gestaltungsmöglichkeiten beim Stimmrecht sollten aber vorsichtig genutzt werden – hier können komplexe Konstruktionen entstehen, die neue Eigentümer benachteiligen, insbesondere wenn Öffnungsklauseln ins Spiel kommen.
Eine transparente Stimmregelung, die der Größe oder Bedeutung der Einheiten angemessen ist, hilft der Gemeinschaft. Ebenso kann geregelt werden, ob ein Eigentümer mit mehreren Wohnungen mehrere Stimmen hat oder nur eine (abweichend vom Gesetz).
Kosten- und Lastenverteilung
Per Gesetz werden die Kosten der Gemeinschaft in der Regel nach Miteigentumsanteilen verteilt (§ 16 WEG). In der Teilungserklärung kann jedoch eine abweichende Kostenverteilung für das gemeinschaftliche Eigentum einer Wohnanlage vereinbart werden, soweit gesetzlich zulässig.
Beispielsweise kann festgelegt werden, dass bestimmte Kosten nur von den Nutznießern getragen werden (etwa Aufzugskosten nur durch die Bewohner der oberen Stockwerke) oder dass Instandhaltungskosten für bestimmte Gemeinschaftsteile anders aufgeteilt werden.
Auch können Ausnahmen geregelt werden, etwa dass jeder Sondereigentümer kleinere Reparaturen an seinem Sondereigentum selbst trägt, auch wenn es eigentlich Gemeinschaftseigentum betrifft (z.B. Fensterglas, für das der jeweilige Eigentümer die Kosten allein trägt). Wichtig: Solche Regelungen müssen klar und ausdrücklich in der Gemeinschaftsordnung stehen, da sonst die gesetzlichen Vorgaben greifen.
Eine ausgewogene, eindeutig formulierte Kostenverteilungsregel kann viele Streitigkeiten über Geld verhindern. Zum Beispiel könnte man regeln, dass gemeinschaftliche Fenster zwar Gemeinschaftseigentum sind, aber der Austausch eines von innen beschädigten Fensters vom jeweiligen Wohnungseigentümer zu zahlen ist (um die Gemeinschaft nicht mit individuellen Schadenskosten zu belasten).
Nutzungs- und Gebrauchsregelungen
Die Teilungserklärung kann festhalten, wie die Wohnungen genutzt werden dürfen. Etwa kann bestimmt werden, dass bestimmte Einheiten als Teileigentum nur gewerblich oder büromäßig genutzt werden dürfen (z.B. ein Ladenlokal), oder umgekehrt, dass Wohnungen nicht zu Gewerbezwecken (wie Ferienwohnung, AirBnB, Kanzlei/Praxis) genutzt werden sollen. Häufig wird festgelegt, dass bestimmte Räume „nur zu Wohnzwecken“ genutzt werden dürfen.
Auch Regelungen zu Lärm, Musizieren, Tierhaltung, Grillen auf dem Balkon etc. können – zumindest grundsätzliche – in der Gemeinschaftsordnung getroffen werden. Ein häufiger Wunsch ist eine Klausel, ob gewerbliche Nutzung der Wohneinheiten zulässig ist oder ob dies untersagt bzw. an Zustimmung gebunden ist.
Ebenso kann geregelt werden, ob die Haltung von Haustieren wie Hunde verboten ist und unter welchen Bedingungen Nachbarn durch tierischen Lärm nicht gestört werden dürfen. Solche Nutzungsbeschränkungen sind zulässig, solange sie nicht unangemessen oder diskriminierend sind, und sollten im Interesse eines harmonischen Zusammenlebens klar formuliert werden.
Regelungen zur Verwaltung und Gemeinschaftsleben
In der Gemeinschaftsordnung kann außerdem die Organisation der Verwaltung genauer bestimmt werden. Beispielsweise: Soll ein externer WEG-Verwalter bestellt werden oder erfolgt die Verwaltung in Eigenregie der Eigentümer? Man kann festlegen, unter welchen Voraussetzungen ein Verwalter abberufen werden kann oder spezielle Qualifikationen fordern.
Auch die Durchführung von Eigentümerversammlungen (z.B. Einberufungsfristen, Mehrheitsanforderungen über das Gesetz hinaus) und ggf. schriftliche Beschlussfassungen können konkretisiert werden.
Manche Teilungserklärungen enthalten auch ein Vorkaufsrecht der übrigen Eigentümer für den Fall, dass ein Eigentümer seine Wohnung verkauft – dies muss ausdrücklich vereinbart sein und kann für eine homogene Gemeinschaft sorgen, ist aber seltener und muss im Grundbuch vermerkt werden, um wirksam zu sein. Insgesamt lässt sich die Gemeinschaftsordnung als individuelle „Satzung“ der Eigentümergemeinschaft verstehen, die vieles regeln kann, was das Gesetz den Eigentümern zur autonomen Vereinbarung freistellt.
Öffnungsklauseln für spätere Änderungen
Eine Besonderheit, die in vielen neueren Gemeinschaftsordnungen zu finden ist, sind sogenannte Öffnungsklauseln. Das sind Klauseln, die es der Eigentümerversammlung ermöglichen, abweichend von der Einstimmigkeit bestimmte Regelungen der Gemeinschaftsordnung mit qualifizierter Mehrheit zu ändern.
Beispielsweise könnte eine Öffnungsklausel vorsehen, dass die Verteilung der Betriebskosten oder die Hausordnung durch Mehrheitsbeschluss angepasst werden darf, ohne jede Änderung gleich notariell zu beurkunden. Dies macht die Gemeinschaft flexibler, kann aber auch Risiken bergen.
Für die ursprünglichen und zukünftigen Eigentümer bedeutet eine Öffnungsklausel, dass bestimmte Rechte nicht dauerhaft „in Stein gemeißelt“ sind, sondern durch Mehrheitswillen geändert werden können. Typischerweise werden Öffnungsklauseln auf weniger grundsätzliche Bereiche beschränkt (etwa die Verteilung bestimmter Nebenkosten oder die Zeitpunkte der Versammlung).
Wichtig: Solche Klauseln müssen ausdrücklich in der Teilungserklärung/ Gemeinschaftsordnung stehen, da ansonsten Änderungen von Vereinbarungen nur einstimmig möglich sind.
Maßgeschneiderte Gestaltung vermeidet Konflikte
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind insgesamt sehr umfangreich. Allerdings stößt die Vertragsfreiheit dort an Grenzen, wo das Gesetz zwingende Vorgaben macht (z.B. kann man einem Eigentümer nicht das Kern-Stimmrecht komplett entziehen oder gemeinschaftliches Eigentum nicht einfach per Teilungserklärung zu Sondereigentum erklären, wenn das WEG es nicht zulässt).
Grundsatz: Vereinbarungen in der Teilungserklärung gehen den gesetzlichen Regelungen vor, solange sie gesetzlich zulässig sind. Die Teilungserklärung bietet daher viel Raum, die WEG-Standards an die Besonderheiten des Objekts anzupassen – ob es nun ein großes Mehrparteienhaus, eine Reihenhausanlage oder gemischt genutzte Immobilie ist. Eine maßgeschneiderte Gestaltung kann zukünftige Konflikte vermeiden helfen und jedem Eigentümer genau die Rechte und Pflichten zuweisen, die passend erscheinen.
Typische Fehler und Risiken für Streitfälle bei einer Teilungserklärung
Bei der Abfassung einer Teilungserklärung passieren in der Praxis immer wieder Fehler, die später zu rechtlichen Risiken oder Streitigkeiten führen. Unklare Teilungserklärungen führen immer wieder zu Problemen. Hier haben wir eine kleine Auswahl typischer Streitfälle, einige Fehlerquellen und Risiken, auf die man achten sollte, zusammengestellt:
Unklare Abgrenzungen zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum
Wenn die Teilungserklärung nicht eindeutig festlegt, welche Gebäudeteile welchem Eigentumsbereich zugeordnet sind, besteht hohes Konfliktpotenzial. Beispielsweise war lange unklar, wer für den Austausch von Fenstern zuständig ist, da Fenster teils zum Gemeinschaftseigentum zählen, ihr Gebrauch aber dem Sondereigentümer zugutekommt.
Werden solche Punkte nicht präzise geregelt, muss im Streitfall geklärt werden, ob nicht doch die Gemeinschaft zahlen muss. Unschärfen können zu langwierigen Streitigkeiten und sogar Gerichtsverfahren führen. Es ist daher riskant, sich auf allgemeine Formulierungen zu beschränken – jede bauliche Besonderheit (Dachterrassen, Treppen innerhalb von Wohnungen, Kellerzugänge etc.) sollte in der Teilungserklärung berücksichtigt werden, um Klarheit zu schaffen.
Widersprüchliche oder rechtswidrige Klauseln
Manchmal enthalten Teilungserklärungen Formulierungen, die in Konflikt mit dem Wohnungseigentumsgesetz oder anderen Rechtsvorschriften stehen. Beispielsweise wäre eine Klausel, die bestimmten Eigentümern das Stimmrecht generell aberkennt, nichtig, weil sie dem Kern des WEG widerspricht.
Auch dürfen Vereinbarungen nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Solche fehlerhaften Klauseln sind entweder unwirksam – was zu Unsicherheit führt, welche Regel nun gilt (dann greift meist die gesetzliche Regel) – oder sie ziehen Anfechtungen nach sich. Tipp: Lassen Sie die Teilungserklärung von einem im WEG-Recht kundigen Juristen prüfen, um sicherzustellen, dass alle Klauseln wirksam und konsistent sind.
Zu allgemeine oder lückenhafte Regelungen für Rechte und Pflichten
Wird auf die Ausarbeitung einer detaillierten Gemeinschaftsordnung verzichtet und nur das Nötigste festgehalten, klaffen möglicherweise Lücken, die später durch Auslegung oder Mehrheitsbeschlüsse gefüllt werden müssen. Was nicht in der Teilungserklärung steht, richtet sich zwar nach den gesetzlichen Default-Regeln, aber diese passen nicht immer optimal zur Gemeinschaft.
Wenn zum Beispiel nichts über die Verteilung bestimmter Betriebskosten geregelt ist, gilt zwar das Gesetz (Verteilung nach Anteilen), aber vielleicht wäre eine abweichende Verteilung gerechter gewesen – das zu ändern ist später aufwendig.
Auch das Schweigen zu Nutzungsregelungen (etwa gewerbliche Nutzung) kann zu Streit führen, wenn ein Eigentümer dann z.B. ein lautes Gewerbe in seiner Einheit betreiben möchte und die anderen das nicht dulden wollen. Fehlende Klarstellungen sind daher ein Risiko. Es lohnt sich, im Vorfeld genau zu überlegen, welche Punkte potentiell konfliktträchtig sein könnten, und diese proaktiv in der Gemeinschaftsordnung zu regeln.
Missbräuchliche Öffnungsklauseln
Öffnungsklauseln erleichtern zwar Anpassungen, können aber auch Tücken haben. Eine breit formulierte Öffnungsklausel, die es erlaubt, nahezu alle Vereinbarungen per Mehrheitsbeschluss zu ändern, kann insbesondere spätere Käufer benachteiligen.
Diese erwerben die Wohnung vielleicht in der Annahme, dass die im Kaufzeitpunkt geltenden Regeln Bestand haben – müssen aber feststellen, dass die Gemeinschaft mit Mehrheit plötzlich die Hausordnung oder Kostenverteilung zu ihren Ungunsten ändern kann. Für ursprüngliche Eigentümer mag das bei Aufstellung der TE praktisch erscheinen, aber neue Eigentümer hatten an der ursprünglichen Festlegung keinen Anteil und können sich überrumpelt fühlen.
Solche Klauseln müssen sehr sorgfältig und begrenzt eingesetzt werden (z.B. nur für bestimmte untergeordnete Bereiche zulässig sein). Andernfalls besteht das Risiko, dass sie zu Unfrieden führen oder im Extremfall gerichtlich als unwirksam eingestuft werden, wenn sie übermäßig benachteiligend sind.
Falsche oder unfaire Kostenverteilung
Ein häufiger Streitpunkt in Eigentümergemeinschaften ist die Verteilung von Kosten und Lasten. Wenn die festgelegten Schlüssel als unfair empfunden werden – etwa weil ein Penthouse-Eigentümer mit großem Anteil unverhältnismäßig viel zahlt, obwohl er bestimmte Einrichtungen kaum nutzt – führt das zu Dauerfrust. Natürlich lässt sich nicht jede Unzufriedenheit vermeiden, aber grobe Unausgewogenheiten oder Fehler (z.B. Rechenfehler bei den Anteilen, die keine 100 % ergeben) in der TE sollten unbedingt vermieden werden. Auch sollte man vorsichtig sein mit Ausnahmen:
Werden bestimmte Wohnungen weitgehend von Gemeinschaftskosten freigestellt (etwa eine Gewerbeeinheit zahlt nichts für den Garten, nutzt aber vielleicht doch indirekt Vorteile), kann dies Unmut erzeugen. Kurz gesagt: eine transparente und als gerecht empfundene Regelung ist wichtig. Fehler hier rächen sich langfristig.
Fehlende oder fehlerhafte Abgeschlossenheitsbescheinigung/ Aufteilungsplan
Ein formeller Aspekt: Wenn bei Einreichung beim Grundbuchamt festgestellt wird, dass die Pläne nicht den Anforderungen entsprechen oder die Abgeschlossenheitsbescheinigung fehlt, verzögert sich der Vollzug der Teilung.
Dieses Risiko ist vor allem dann gegeben, wenn die Vorbereitung eilig oder nachlässig erfolgte. Etwaige Mängel müssen dann nachgebessert werden, was Zeit und Geld kostet. Schlimmstenfalls können bis zur Korrektur keine Wohnungen verkauft werden. Hier liegt der Fehler oft im Detail – etwa unvollständige Planunterlagen, fehlende Siegel der Behörde oder unklare Maßangaben. Daher sollte man diesem Vorbereitungsschritt große Sorgfalt widmen.
Risiko, wenn eine Teilungserklärung nachträglich geändert werden soll
Ein implizites Risiko jeder Teilungserklärung ist, dass Fehler praktisch nur einstimmig korrigiert werden können, sobald die Wohnungen verkauft sind. In dem Moment, wo mehrere Eigentümer in der WEG sind, müssen alle einer Änderung zustimmen und diese muss wiederum notariell beurkundet und ins Grundbuch eingetragen werden. Eine Teilungserklärung kann also nur unter strengen Voraussetzungen nachträglich geändert werden.
Das ist aufwendig und oft kaum zu erreichen (weil immer jemand Nachteile befürchtet). Daher haben anfängliche Fehler oder Versäumnisse eine erstaunliche Lebensdauer – fehlerhafte oder unklare Teilungserklärungen können eine Gemeinschaft Jahrzehnte begleiten.
Dieses Risiko unterstreicht, wie wichtig eine gründliche und fehlerfreie Erstellung der Teilungserklärung von Anfang an ist. Ein Bauträger, der „Schema F“-Dokumente verwendet und individuelle Gegebenheiten ignoriert, hinterlässt den Käufern unter Umständen problematische Regelungen, die sie dann nicht loswerden. Auch Eigentümer, die alleine aufteilen, sollten nicht versuchen, an professioneller Beratung zu sparen – die Korrektur kostet später ein Vielfaches mehr als die Initialkosten für die Teilungserklärung und nervt alle Beteiligten.
Zusammenfassend liegen die größten Risiken in Unklarheiten, Ungerechtigkeiten oder unzulässigen Klauseln. Viele dieser Fehler lassen sich durch sorgfältige Planung und juristische Expertise vermeiden. Es empfiehlt sich, die Teilungserklärung von Fachleuten erstellen zu lassen (Notar oder Rechtsanwalt für WEG-Recht) bzw. zumindest prüfen zu lassen. So stellt man sicher, dass das Dokument rechtlich einwandfrei, vollständig und ausgewogen ist – zum Vorteil aller Eigentümer.
Ablauf der Erstellung und Eintragung
Wie geht man nun praktisch vor, wenn man eine Teilungserklärung erstellen lassen möchte? Die Erstellung und Eintragung gliedert sich im Wesentlichen in folgende Schritte:
1. Planung und Aufteilungsplan erstellen
Zunächst sollten alle Unterlagen zur Immobilie zusammengestellt werden. Beauftragen Sie möglichst früh einen Architekten oder Planer mit der Erstellung eines Aufteilungsplans (Bauzeichnung), der die Aufteilung in die einzelnen Wohnungen genau darstellt. Dieser Plan muss alle relevanten Details enthalten (Grundrisse aller Stockwerke mit Nummerierung der Wohnungen, ggf. Ansichten und Schnitte) und wird später vom Bauamt geprüft.
Falls bauliche Änderungen nötig sind, um abgeschlossene Wohnungen zu schaffen (z.B. das Einziehen zusätzlicher Wände oder Trenntüren) oder wenn zwei Wohnungen zusammengelegt werden sollen, sollten diese vorab erledigt oder zumindest genehmigt sein. Der Architekt kann auch beraten, welche Angaben der Plan enthalten muss (Lageplan, Wohnungsgrößen, Räume pro Einheit etc.). Im Idealfall stimmen Sie den Planentwurf schon informell mit der Baubehörde ab, um sicherzugehen, dass er genehmigungsfähig ist.
2. Abgeschlossenheitsbescheinigung beantragen
Mit dem fertigen Aufteilungsplan (oder parallel dazu) beantragen Sie beim zuständigen Bauamt oder der Bauaufsichtsbehörde die Abgeschlossenheitsbescheinigung. Die Behörde prüft, ob jede Wohneinheit gemäß den Bauvorschriften abgeschlossen und mit den erforderlichen eigenen Räumen ausgestattet ist (etwa eigene Sanitäreinrichtungen).
Dafür müssen meist mehrere Exemplare des Aufteilungsplans eingereicht werden, die dann abgestempelt und mit einem Bescheid versehen zurückkommen. Die Ausstellung kostet je nach Gemeinde und Aufwand eine Gebühr (typisch ca. 30 bis 100 Euro).
Unser Tipp: Planen Sie etwas Zeit ein – je nach Behörde kann die Bearbeitung wenige Wochen dauern. Ohne diese Bescheinigung kann das Grundbuchamt die Teilung nicht vollziehen, daher ist dieser Schritt entscheidend. Sobald Sie die Bescheinigung erhalten haben (oft mit Originalstempel auf den Plänen), halten Sie alle Unterlagen bereit für den Notar.
3. Teilungserklärung aufsetzen (Entwurf)
Im nächsten Schritt wird der Text der Teilungserklärung samt Gemeinschaftsordnung vorbereitet. Wer erstellt die Teilungserklärung? – Üblicherweise entwirft entweder der Eigentümer (bzw. Bauträger) selbst einen Entwurf, oft aber übernimmt der Notar diese Aufgabe oder es wird ein Rechtsanwalt hinzugezogen. Viele Notare haben Muster, die an den konkreten Fall angepasst werden. In jedem Fall sollte der Entwurf die speziellen Gegebenheiten Ihrer Immobilie berücksichtigen.
Im Entwurf werden alle zuvor genannten Gestaltungspunkte festgelegt: die Beschreibung des Grundstücks, die Aufteilung in X Wohnungen, die Bezeichnung (Nummerierung) jeder Einheit, die Größe und der Miteigentumsanteil, Zuweisung von Sondernutzungsrechten, Regelungen der Gemeinschaftsordnung (Nutzung, Kosten, Verwaltung, usw.). Nehmen Sie sich Zeit, alle gewünschten Regelungen aufzunehmen. Bei Bauträger-Projekten erstellt meist der Bauträger den Entwurf und lässt ihn vom Notar prüfen. Als Orientierung können Sie auch bestehende
Teilungserklärungen ähnlicher Objekte ansehen oder einen Experten beauftragen. Wichtig ist, dass der Entwurf vor der notariellen Beurkundung mit allen Beteiligten abgestimmt ist (bei Alleineigentümer ist das nur er selbst; bei mehreren müssen alle einverstanden sein). Änderungen nach der Beurkundung sind schwierig, daher gründlich arbeiten.
4. Notarielle Beurkundung der Teilungserklärung
Vereinbaren Sie nun einen Termin beim Notar, um die Teilungserklärung zu unterschreiben und beurkunden zu lassen. Der Notar wird zunächst prüfen, ob alle notwendigen Dokumente vorliegen: aktueller Grundbuchauszug des Grundstücks, der beglaubigte Aufteilungsplan mit Abgeschlossenheitsbescheinigung, Personaldokumente des Eigentümers, etc. Im Notartermin wird der Inhalt der Teilungserklärung vorgelesen und erläutert, damit alle Klarheit über die Regelungen haben.
Falls noch Fehler oder Unklarheiten auffallen, können diese im Termin korrigiert werden. Schließlich unterschreibt der Eigentümer (bzw. alle Miteigentümer) die Erklärung und der Notar bestätigt dies mit seiner Unterschrift und Siegel (Beurkundung). Damit ist die Teilungserklärung formal errichtet. Der Notar ist dafür verantwortlich, die Öffentliche Beglaubigung bzw. Beurkundung ordnungsgemäß vorzunehmen – nur so wird die Erklärung vom Grundbuchamt akzeptiert.
Gegebenenfalls erklärt der Notar auch gleich die Eintragung bewilligend (§ 8 WEG verlangt die Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt, was in der notariellen Urkunde bereits enthalten ist). Anmerkung: In diesem Stadium fallen bereits Notarkosten an (siehe Abschnitt Kosten).
5. Einreichung beim Grundbuchamt
Nachdem die notarielle Urkunde erstellt ist, sorgt in der Regel der Notar für die Einreichung der Unterlagen beim Grundbuchamt. Er versendet oder übermittelt digital die Teilungserklärungs-Urkunde, den Aufteilungsplan (meist als beglaubigte Kopie mit Siegel) und die Abgeschlossenheitsbescheinigung an das zuständige Grundbuchamt, zusammen mit dem Antrag, nun die Aufteilung im Grundbuch vorzunehmen.
In manchen Fällen erhält der Eigentümer auch eine Kopie der Teilungserklärung, aber grundsätzlich läuft die Kommunikation mit dem Grundbuchamt über den Notar. Eine Kopie kann später beim Grundbuchamt oder Notar angefordert werden. Das Grundbuchamt prüft dann alle Unterlagen auf Vollständigkeit und Rechtskonformität. Sollte etwas fehlen oder unklar sein, fordert es eine Ergänzung oder Korrektur an – in diesem Fall wird der Notar Sie informieren und um Nachreichung bitten. Wenn alles in Ordnung ist, wird das Grundbuchamt die Eintragung vornehmen.
6. Eintragung und Anlage der Wohnungsgrundbücher
Im letzten Schritt entstehen die einzelnen Wohnungsgrundbuchblätter. Das Grundbuchamt trägt für jede Wohnung ein neues Grundbuchblatt (oder Grundbuchunterseite) ein, in dem der jeweilige Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigentum an Wohnung Nr. X vermerkt wird.
Zugleich wird im Bestandsverzeichnis des Hauptgrundbuchs (Stammgrundstück) vermerkt, dass Wohnungseigentum gemäß Teilungserklärung vom [Datum] bestehend aus z.B. 10 Wohnungen gebildet wurde. Ab diesem Zeitpunkt existiert rechtlich für jede Wohnung ein separates Eigentum, das z.B. mit eigenen Grundpfandrechten belastet oder an Käufer übertragen werden kann.
Wenn der ursprüngliche Eigentümer alle Wohnungen behält, ist er nun formal Alleineigentümer von z.B. Wohnung Nr. 1 bis 10, jeweils mit eigenem Grundbuch. Verkauft er eine Wohnung, wird der Käufer als neuer Eigentümer im entsprechenden Wohnungsgrundbuch eingetragen.
Die Eigentümergemeinschaft nach WEG entsteht spätestens mit Eintritt eines weiteren Eigentümers (früher erst dann, heute – nach WEMoG 2020 – gilt die Gemeinschaft als entstanden, sobald die Eintragung der Teilung vollzogen ist, auch wenn zunächst eine Person alle Einheiten hält). Nach der Eintragung erhalten Sie vom Grundbuchamt in der Regel eine Abschrift der Grundbucheinträge oder zumindest eine Mitteilung, dass die Eintragung erfolgt ist. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.
Vom Start (Planung) bis zur Eintragung vergehen – je nach Voraussetzungen – etwa einige Wochen bis wenige Monate. Mit guter Vorbereitung (Pläne/Bescheinigung) kann die notarielle Beurkundung zeitnah erfolgen; die Bearbeitung beim Grundbuchamt richtet sich nach dessen Auslastung (oft 4-6 Wochen). Während dieses Prozesses steht Ihnen der Notar mit Rat und Tat zur Seite.
Hinweis: In diesem Ablauf sind die Schritte für den häufigsten Fall (Alleineigentümer teilt sein Haus auf) beschrieben. Bei Sonderkonstellationen, etwa wenn Miteigentümer nach § 3 WEG aufteilen, läuft es ähnlich, nur dass alle Beteiligten den Vertrag schließen. Auch eine bereits eingetragene Gemeinschaftsordnung, falls nachträglich ergänzt, würde notariell vereinbart und grundbuchlich eingetragen (siehe evtl. separate Schritte).
Wie hoch sind die Kosten einer Teilungserklärung?
Die Erstellung einer Teilungserklärung ist mit verschiedenen Kosten verbunden. Für Eigentümer und Bauträger ist es wichtig, diese von vornherein einzukalkulieren. Hier ein Überblick der typischen Kostenfaktoren:
Kosten für Aufteilungsplan und Abgeschlossenheitsbescheinigung
Die Beauftragung eines Architekten oder Planers zur Erstellung der erforderlichen Bauzeichnungen verursacht je nach Aufwand Kosten (häufig einige hundert Euro, abhängig von Größe und Komplexität des Objekts). Zusätzlich verlangt die Baubehörde für die Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung eine Gebühr.
Insgesamt bewegen sich Planung und Bescheinigung meist im Rahmen von ca. 100 € bis 500 €, wobei einfache Fälle (z.B. kleines Objekt, bestehende Pläne vorhanden) eher am unteren Ende liegen. In komplexeren Fällen oder bei umfangreichen Zeichnungen kann es mehr sein. Diese Ausgaben trägt zunächst der Eigentümer, können aber z.B. vom Bauträger in den Wohnungspreisen einkalkuliert werden.
Was kostet eine notarielle Teilungserklärung?
Die größte Kostengruppe sind die Notargebühren für die Beurkundung der Teilungserklärung. Diese Gebühren sind gesetzlich festgelegt (Gerichts- und Notarkostengesetz, GNotKG) und richten sich nach dem Wert der Immobilie. Dabei wird bei Teilungserklärungen typischerweise ein halber Immobilienwert als Geschäftswert angesetzt.
Ein Beispiel zur Orientierung: Beträgt der Gesamtwert des Grundstücks/Objekts 1.000.000 €, setzt man einen Gesamtwert von 500.000 € als Wert an – bei 500.000 Euro liegt die Notargebühr gemäß Gebührentabelle bei ca. 935 €.
Was kostet die Aufteilung eines Mehrfamilienhauses in Eigentumswohnungen?
Bei einem kleineren Mehrfamilienhaus mit z.B. bei einem Gesamtwert von 500.000 Euro wären die Gebühren entsprechend niedriger (etwa 535 € bei 250.000 € Wert). Hinzu kommen geringfügige Auslagen (für Kopien, Telekommunikation) und die Mehrwertsteuer.
Wichtig: Diese Kosten fallen unabhängig von der Zahl der Wohnungen an, orientieren sich nur am Immobilienwert. Wenn Sie die Teilungserklärung ohne große Hilfestellung des Notars selbst entwerfen und der Notar nur die Unterschrift beglaubigt, könnten die Gebühren etwas niedriger liegen (öffentliche Unterschriftsbeglaubigung ca. 70–140 €).
In der Praxis wird aber – wie erwähnt – meist eine Vollbeurkundung nötig, sodass man mit einigen hundert bis rund tausend Euro Notarkosten rechnen sollte. Notarkosten sind per Gesetz fix; ein Preisvergleich lohnt nicht, da jeder Notar bei gleichem Geschäftswert die gleichen Gebühren berechnet.
Wie hoch sind die Grundbuchkosten bei einer Teilungserklärung?
Für die Eintragung von neuen Wohnungseigentum erhebt das Grundbuchamt ebenfalls Gebühren. Diese sind deutlich geringer als die Notargebühren. Pro neu angelegtem Wohnungsgrundbuch fällt eine Gebühr nach Wert an, in Summe oft im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich.
Beispielsweise werden häufig 50 € bis 150 € für die gesamte Aufteilung genannt, abhängig von der Anzahl der Einheiten und dem Amtsaufwand. Auch hier gilt: Die Gebührenordnung regelt dies verbindlich. Bei unserem Beispiel (1 Mio. € Objekt, 10 Wohnungen) könnten um die 300–500 € Grundbuchgebühren anfallen (ungefähre Schätzung). Diese Kosten betreffen ebenfalls zunächst den teilenden Eigentümer.
Wie hoch sind die sonstigen Kosten für eine Teilungserklärung?
Eventuell entstehen Beratungskosten, falls Sie einen Rechtsanwalt oder Sachverständigen zur Beratung hinzuziehen, was durchaus empfehlenswert sein kann. Dies wäre frei verhandelbar und hängt vom Umfang der Tätigkeit ab.
Bauträger haben diese Expertise oft inhouse oder durch standardisierte Vorlagen. Außerdem sollten Verkäufer von vermieteten Wohnungen bedenken, dass Benachrichtigungskosten für Mieter (bei Umwandlung müssen bestehende Mieter über den neu geschaffenen Wohnungsverkehrswert informiert werden, um ihr gesetzliches Vorkaufsrecht auszuüben) geringfügig anfallen können. Solche Posten sind jedoch vergleichsweise marginal.
Wie hoch sind die gesamten Notar- und Grundbuchkosten?
Insgesamt bewegen sich die Gesamtkosten für eine Teilungserklärung typischerweise in einer Größenordnung von etwa 0,2–0,5 % des Immobilienwerts. Für ein mittleres Objekt kann man grob 2.000 bis 3.000 € veranschlagen, inkl. aller Nebenkosten. Natürlich hängt dies stark vom Einzelfall ab: Bei sehr hochpreisigen Objekten steigt die Notargebühr entsprechend; bei kleineren Objekten bleibt alles überschaubar günstiger.
Beachten Sie, dass diese Kosten zunächst vom aktuellen Eigentümer getragen werden müssen (Bauträger legen sie oft auf die Käufer um, indem sie Teil der Kaufpreise werden).
Für Käufer einer Eigentumswohnung ist die gute Nachricht: Die Kosten für die Teilungserklärung sind in der Regel bereits „vorgeleistet“ und im Kaufpreis enthalten. Sie müssen sie nicht separat zahlen, sondern nur die üblichen Kaufnebenkosten (Notar und Grundbuch für den Wohnungskauf selbst).
Abschließend sei erwähnt, dass eine notarielle Teilungserklärung mit ihren Kosten auch als Investition in Rechtssicherheit gesehen werden kann. Die Aufwendungen sind vergleichsweise gering im Verhältnis zum Immobilienwert, schützen aber vor erheblichen rechtlichen Problemen. Konflikte im Nachgang können viel teurer werden. Daher: Lieber von Anfang an etwas mehr in eine wasserdichte Gestaltung investieren, als später teure Streitigkeiten führen zu müssen.
Fazit: Inhalte, Kosten und Streitfälle der Teilungserklärung
Die Teilungserklärung ist für Eigentümer von Immobilien, die in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden sollen, ein unverzichtbares Instrument. Sie bildet die rechtliche Grundlage für das Wohnungs- und Teileigentum und legt alle wichtigen Spielregeln innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft fest.
Eine sauber ausgearbeitete und rechtssichere Teilungserklärung nach § 8 WEG – idealerweise ergänzt durch eine passende Gemeinschaftsordnung – bietet zahlreiche Vorteile: Sie schafft Rechtssicherheit, verhindert viele Konflikte unter den Wohnungseigentümern und erfüllt die Voraussetzungen, um Wohnungen einzeln zu verkaufen oder zu beleihen. Insbesondere für Bauträger und Kapitalanleger ist sie der Schlüssel, um aus einer Liegenschaft maximalen Wert zu schöpfen und rechtliche Risiken zu minimieren.
Es wurde deutlich, dass es einige Voraussetzungen (Aufteilungsplan, Abgeschlossenheitsbescheinigung, notarielle Beurkundung etc.) zu beachten gilt und dass die Gestaltungsmöglichkeiten groß sind. Genau hierin liegt jedoch auch die Verantwortung: Fehler oder Nachlässigkeiten bei der Erstellung der Teilungserklärung können später teuer und ärgerlich werden. Typische Fallstricke – von unklaren Regelungen bis zu ungewollten Rechtsfolgen – lassen sich aber vermeiden, wenn man von Beginn an sorgfältig vorgeht und gegebenenfalls Expertenrat einholt.
Für Eigentümer, die eine Teilungserklärung erstellen lassen möchten, empfiehlt es sich, frühzeitig Notar und ggf. fachkundige Rechtsberatung einzubinden. Ein Notar ist ohnehin gesetzlich erforderlich; er kann auch bei der inhaltlichen Gestaltung unterstützen, achtet jedoch vor allem auf die Form. Ein Rechtsanwalt für WEG-Recht kann zusätzlich dabei helfen, die Gemeinschaftsordnung nach den Wünschen der Eigentümer zu optimieren und auf mögliche Risiken hinzuweisen. Lassen Sie sich zusätzlich beraten – Diese professionelle Begleitung stellt sicher, dass das Dokument klar, vollständig und zukunftsfest ist.
Ausführliche Artikel liefern Hintergrundinfos rund um die Teilungserklärung. Weitere Themen aus dem Bereich Immobilien finden Sie auf unserer Webseite. Rechtzeitige Planung, klare Regelungen und notarielle Absicherung zahlen sich aus. Sind alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt und die Vorteile genutzt, profitieren alle – Eigentümer erhalten Rechtssicherheit über ihr Sondereigentum, die Gemeinschaft hat ein stabiles Fundament für ihr Zusammenleben, und Konflikte sowie juristische Auseinandersetzungen können maßgeblich reduziert werden.
Für Rechtsanwälte, Verwalter und Berater ergibt sich die Chance, Mandanten durch eine fachkundige Erstellung oder Prüfung der Teilungserklärung vor solchen Problemen zu bewahren und zu einer erfolgreichen Aufteilung von Eigentumswohnungen beizutragen.
Wenn Sie also planen, Ihr Haus in Eigentumswohnungen aufzuteilen oder Fragen zu einer bestehenden Teilungserklärung haben, zögern Sie nicht, fachkundigen Rat einzuholen. Eine gut gemachte Teilungserklärung ist die beste Versicherung für ein harmonisches und rechtssicheres Miteinander in Ihrer Wohnungseigentümergemeinschaft. Jetzt kennen Sie die Voraussetzungen, Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten – dem erfolgreichen Start Ihrer WEG steht damit (fast) nichts mehr im Wege!